Microsoft, Monokulturen und Macht:
Warum digitale Souveränität ohne Wettbewerb eine Illusion bleibt Die Debatte um digitale …
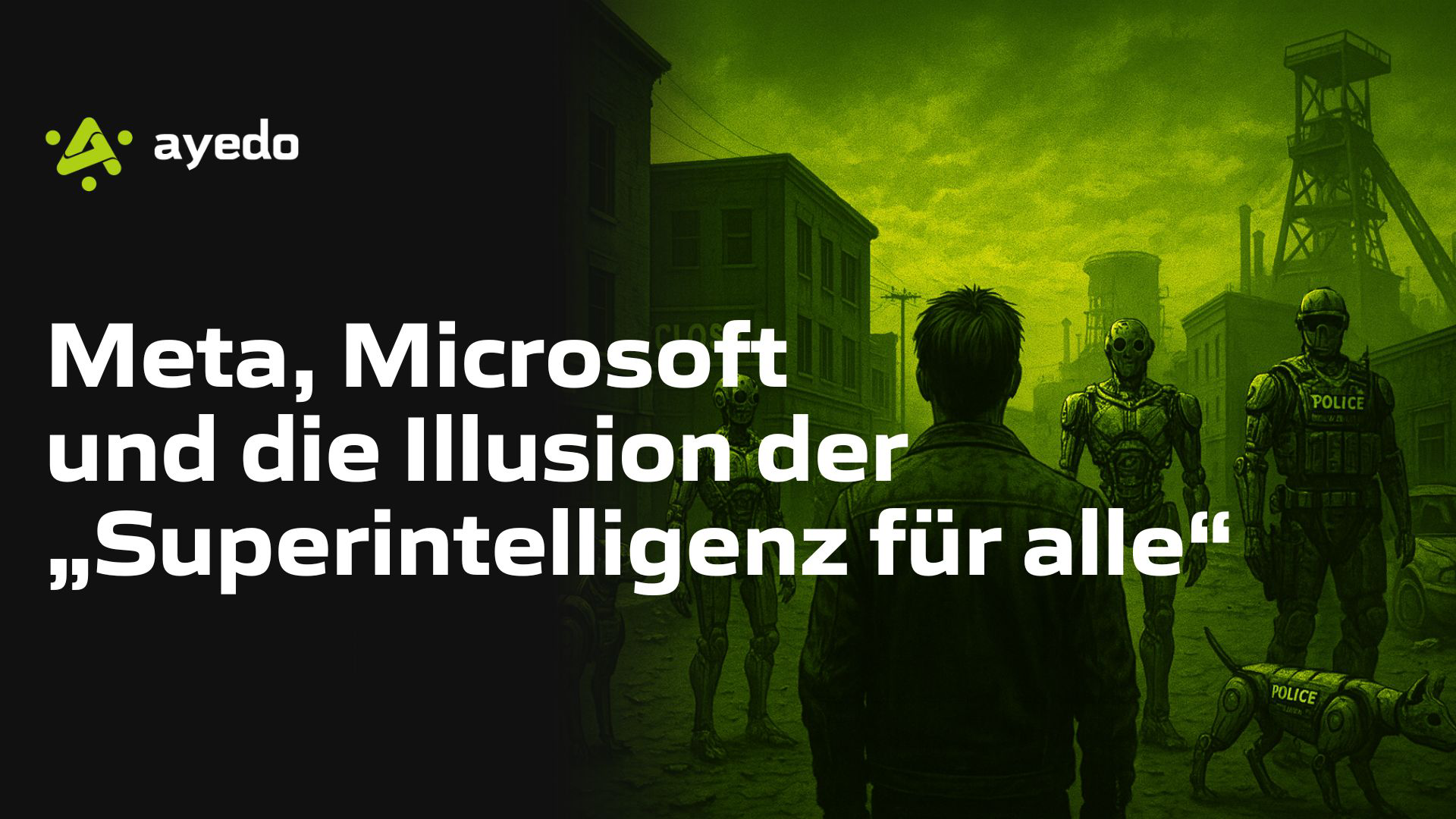
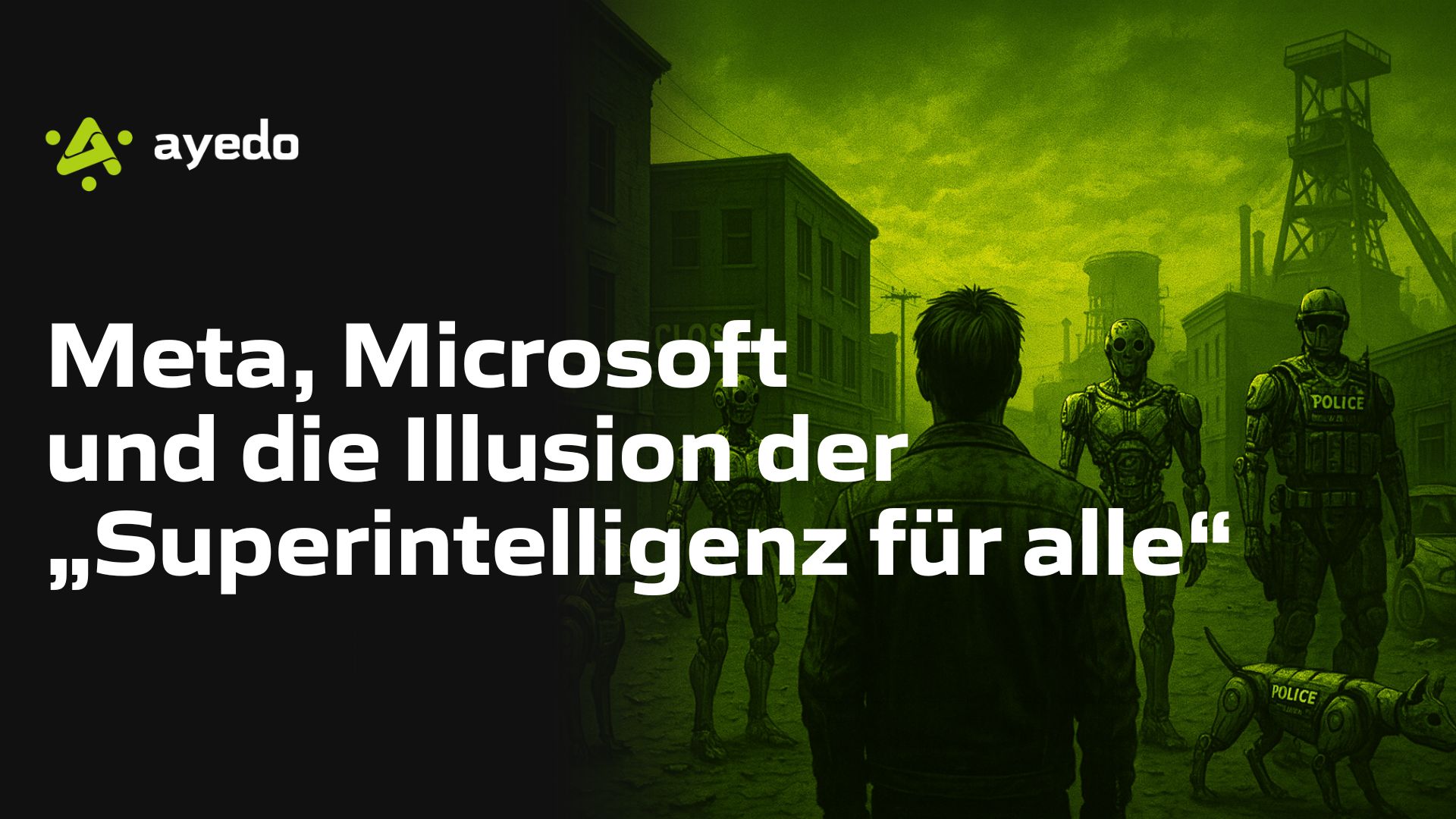
Ende Juli 2025 veröffentlichte Meta seine aktuellen Quartalszahlen – und neben den starken Umsätzen (22 % Wachstum auf 47,52 Mrd. US-Dollar, Gewinnsteigerung um 36 % auf 18,34 Mrd. US-Dollar) präsentierte Mark Zuckerberg vor allem eine Botschaft: Die „Superintelligenz" sei in greifbarer Nähe. Meta wolle „eine persönliche Superintelligenz für alle Menschen der Welt schaffen".
Parallel dazu legte auch Microsoft glänzende Zahlen vor: Ein Umsatzsprung von 18 % auf 76,4 Mrd. US-Dollar, ein Gewinnanstieg um 22 % auf 27,2 Mrd. US-Dollar und ein Cloud-Wachstum von 25 %. Mit diesen Zahlen stößt Microsoft in den Vier-Billionen-Dollar-Club vor, gemeinsam mit Nvidia, während Meta sich auf eine Marktkapitalisierung von zwei Billionen Dollar zubewegt. Der KI-Boom treibt die Börse – und wird als historischer Wendepunkt verkauft.
Doch jenseits der Euphorie stellt sich die Frage: Was bedeutet es, wenn Big Tech von „Superintelligenz" spricht – und was steckt wirklich dahinter?
Zuckerberg definiert „Superintelligenz" als eine Form künstlicher Intelligenz, die die menschliche Intelligenz in allen Bereichen übersteigt. Gemeint ist nicht mehr nur die Spezialisierung auf einzelne Aufgaben (wie Sprachmodelle oder Bildanalyse), sondern eine KI, die in der Lage ist, komplexe Probleme eigenständig zu lösen und sich selbst zu verbessern.
Der entscheidende Punkt ist die rekursive Selbstverbesserung: Systeme, die ihre eigenen Algorithmen optimieren, Trainingsmethoden anpassen und ihre Leistungsfähigkeit steigern – ohne dass Menschen direkt eingreifen. Das gilt in der Forschung seit Jahrzehnten als kritischer Kipppunkt, weil sich technologische Fortschritte damit exponentiell beschleunigen können.
Eine KI, die sich selbst verbessern kann, verändert die Spielregeln.
Der Übergang von schwachen zu selbstverbessernden Systemen ist nicht nur ein technologisches Thema, sondern auch ein gesellschaftliches und geopolitisches Risiko.
Meta kündigte zusätzliche Investitionen in Höhe von mindestens 66 Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren an. Ziel: gigantische Infrastrukturen, die das Training von Modellen mit Milliarden von Parametern ermöglichen. Diese Summen sind vergleichbar mit staatlichen Infrastrukturprojekten – hier jedoch vollständig in privater Hand. Für Kubernetes-basierte Infrastrukturen bedeutet das neue Skalierungsanforderungen.
Microsoft nannte erstmals konkrete Zahlen für Azure: 75 Milliarden Dollar Jahresumsatz – ein Wachstum von 34 %. Damit bestätigt sich, dass Microsoft die Nummer zwei im Cloud-Markt hinter AWS ist. Zusammen mit Nvidia, das inzwischen ebenfalls über vier Billionen Dollar wert ist, bilden diese Unternehmen ein Oligopol, das die globale KI-Entwicklung dominiert.
Während die US-Regierung (unter Präsident Trump) gerade erst regulatorische Vorgaben für KI gelockert hat, um „Wettbewerbsfähigkeit" zu sichern, schlägt China ein globales Regelwerk vor. Europa diskutiert über Ethik und Akzeptanz, während die technologische Entwicklung an Geschwindigkeit zunimmt.
Die zentrale Frage lautet: Wer kontrolliert Systeme, die sich selbst verbessern können?
Bisher gibt es keine international abgestimmten Mechanismen, keine verbindlichen Standards für Auditierbarkeit oder Sicherheitsprotokolle. Die Entwicklung wird faktisch von den Investitionsentscheidungen weniger Konzerne bestimmt.
Wenn Zuckerberg von einer „persönlichen Superintelligenz für alle" spricht, ist das mehr als Marketing. Es ist ein Machtanspruch: Meta will das Betriebssystem der Zukunft stellen, die Schnittstelle zwischen individueller Intelligenz und maschineller Überlegenheit.
Doch die Gefahr besteht, dass wir uns auf eine Technologie zubewegen, deren Dynamik nicht mehr vollständig kontrollierbar ist. Rekursive Selbstverbesserung könnte Fortschritte bringen, die menschliche Entwicklungszyklen überholen – und uns in eine Abhängigkeit von Systemen treiben, deren Logik wir nicht mehr verstehen.
Meta und Microsoft feiern Quartalszahlen, Investoren feiern den KI-Boom, und die Politik diskutiert über Ethikleitlinien. Doch die eigentliche Frage bleibt: Was passiert, wenn wir KIs entwickeln, die sich selbst verbessern – und wir den Takt nicht mehr bestimmen?
Superintelligenz mag als Vision glänzen. Als Realität könnte sie zur größten Herausforderung unserer Zeit werden.
Warum digitale Souveränität ohne Wettbewerb eine Illusion bleibt Die Debatte um digitale …
Nextcloud souverän betreiben: Warum das „Wie“ entscheidend ist Nextcloud steht für digitale …
Bayerns Digitalstrategie: Mia san Microsoft Mit der neuen Digitalstrategie möchte Bayern Staat und …