Docker Swarm oder Kubernetes - was bereitet weniger Schmerzen?
In vielen Gesprächen mit IT-Leitern, Sysadmins und Architekturverantwortlichen zeigt sich ein …
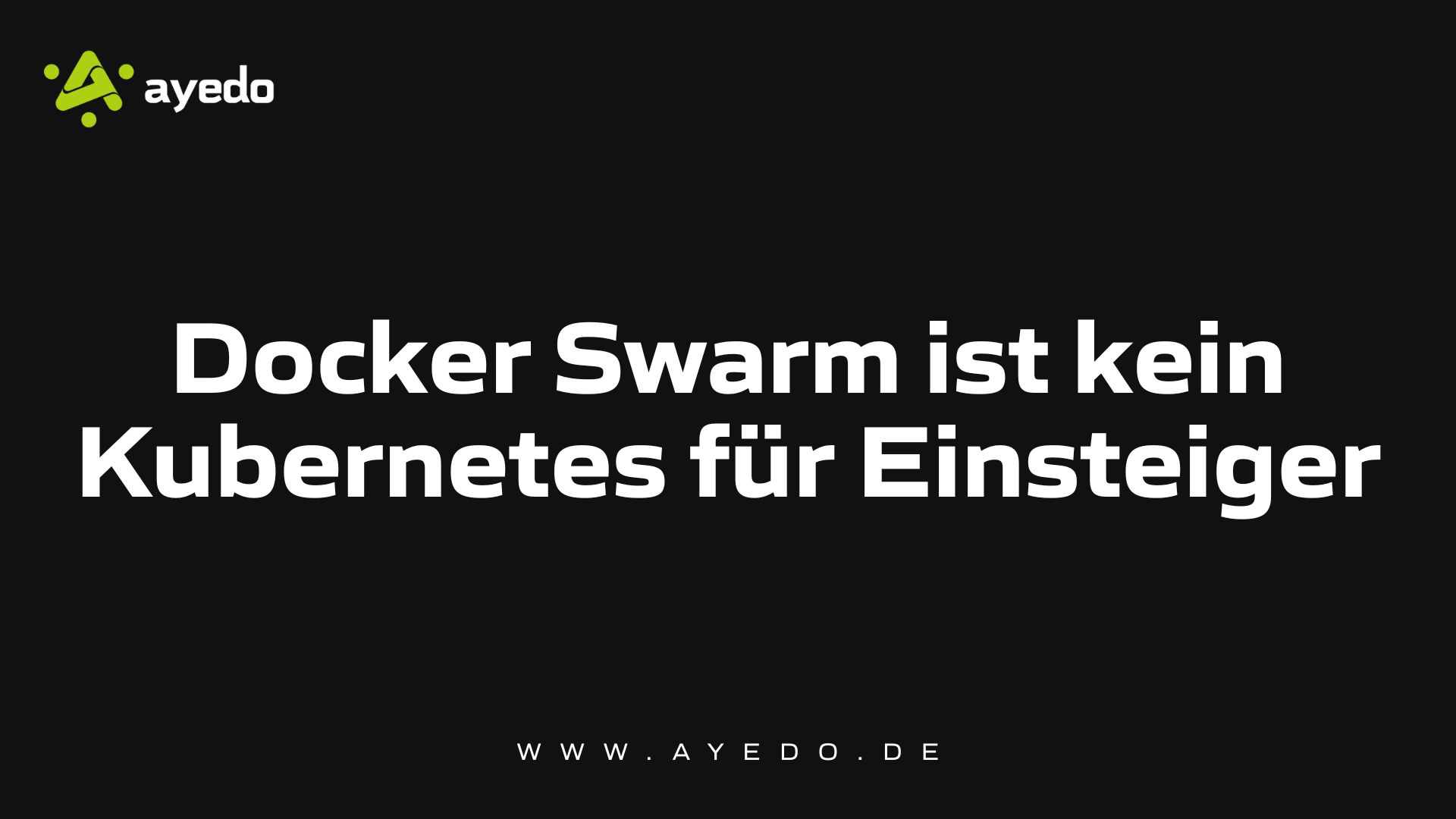
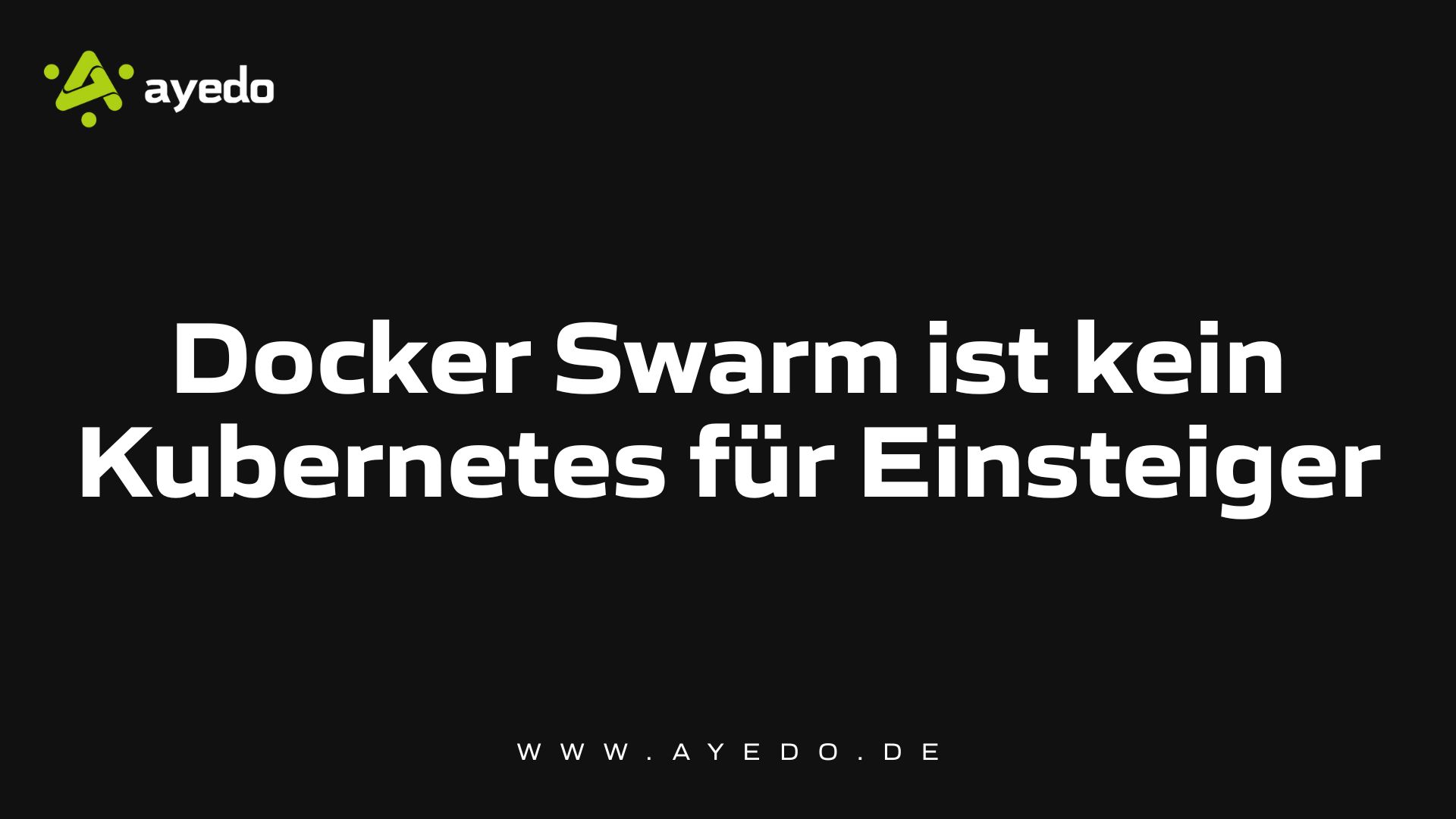

Wer heute über Container-Orchestrierung spricht, landet schnell bei zwei Begriffen: Docker Swarm und Kubernetes. Beide versprechen, Container auf mehreren Maschinen zu betreiben, Dienste zu skalieren und Deployments zu automatisieren. Und weil Kubernetes den Ruf hat, komplex zu sein, greifen viele Organisationen zunächst zu Docker Swarm – in der Hoffnung, sich mit weniger Aufwand in die Welt der Container-Orchestrierung einarbeiten zu können.
Diese Entscheidung wirkt auf den ersten Blick vernünftig. Swarm ist schnell eingerichtet, die Syntax vertraut, die Lernkurve flacher. Es fühlt sich an wie eine natürliche Erweiterung von Docker: ein paar zusätzliche Befehle, ein paar neue YAMLs, und schon ist man in der Welt der Cluster angelangt. Doch diese Einfachheit täuscht.
In der Realität ist Docker Swarm kein „Kubernetes für Einsteiger". Es ist ein eigenständiges, deutlich begrenzteres System, das nur einen Bruchteil der Möglichkeiten von Kubernetes bietet – und dessen Architektur an zentralen Punkten anders gedacht ist. Wer Zeit in Swarm investiert, sollte wissen, dass der Übergang zu Kubernetes später kein „Upgrade" ist, sondern ein kompletter technischer und konzeptioneller Neuanfang.
Dass Swarm und Kubernetes häufig in einem Atemzug genannt werden, hat historische Gründe. Docker war in den Jahren 2014 bis 2016 der zentrale Treiber der Containerbewegung. Als klar wurde, dass Container nicht mehr nur auf einem einzelnen Host, sondern in ganzen Clustern betrieben werden sollten, brachte Docker seine eigene Lösung: Swarm.
Die Idee war bestechend: ein nativer Bestandteil der Docker Engine, kein zusätzlicher Layer, kein externer Scheduler. Wer Docker konnte, konnte auch Swarm. Der Einstieg war damit leicht – im Gegensatz zu Kubernetes, das damals noch als akademisch und schwergewichtig galt.
Doch während Swarm in seiner Einfachheit verharrte, entwickelte sich Kubernetes rasant weiter. Es wurde zum Standard, nicht weil es „mehr kann", sondern weil es auf einem anderen Fundament steht: einem Architekturmodell, das auf Erweiterbarkeit, Resilienz und Governance ausgelegt ist.
Swarm war von Beginn an ein Orchestrator. Kubernetes wurde zu einer Plattform.
Der Unterschied zwischen beiden Systemen beginnt tief in der Architektur. Docker Swarm setzt auf ein einfaches Master-Worker-Modell, bei dem Manager-Nodes den Clusterzustand halten und Worker die Container ausführen. Die Kommunikation erfolgt über eine eingebaute Raft-Implementierung, die den Cluster konsistent hält.
Kubernetes verfolgt ein komplexeres, aber auch robusteres Modell. Die Control Plane besteht aus mehreren Komponenten – API Server, Scheduler, Controller Manager und etcd – die zusammenarbeiten, um den Clusterzustand zu verwalten. Diese Entkopplung ermöglicht Hochverfügbarkeit, bessere Fehlertoleranz und feinere Steuerung.
Swarm ist dabei monolithisch, Kubernetes modular. Swarm versteht Container. Kubernetes versteht Workloads, Policies und Ressourcen.
Dieser Unterschied mag zunächst theoretisch wirken, entfaltet aber im Betrieb seine ganze Tragweite. Swarm kann Container starten, stoppen, verteilen – doch sobald Anforderungen über diesen Grundmechanismus hinausgehen, etwa bei Netzwerksegmentierung, Secrets-Management, komplexem Scheduling oder Observability, stößt es an seine Grenzen.
Kubernetes hingegen denkt von Beginn an in Abstraktionen: Pods, Deployments, Services, Ingress, ConfigMaps, CRDs. Es abstrahiert nicht nur Container, sondern auch deren Verhalten und Beziehungen zueinander. Damit entsteht eine Sprache, in der man Infrastruktur modellieren kann – und genau das macht den Unterschied.
Docker Swarm deckt ein Subset der Funktionen ab, die Kubernetes bietet. Dieses Subset genügt für einfache Anwendungsfälle, etwa das Verteilen von stateless Webdiensten oder kleinen internen Tools. Doch sobald man sich ernsthaft mit Produktivbetrieb, Governance und Skalierung beschäftigt, wird deutlich, wie dünn die Decke ist.
Einige der zentralen Unterschiede lassen sich entlang von Funktionsgruppen erklären.
Deployment und Replikation:
Swarm kennt Services, die in einer bestimmten Anzahl repliziert werden können. Diese Mechanik funktioniert zuverlässig – bis man Dinge wie Rolling Updates, Health Checks, Blue-Green- oder Canary-Deployments benötigt. Kubernetes bietet dafür native Steuerlogik, Swarm nicht.
Netzwerk und Service Discovery:
Swarm nutzt ein eigenes Overlay-Netzwerk mit interner DNS-Auflösung. Das ist einfach, funktioniert aber nur begrenzt performant und skaliert schlecht über mehrere Subnetze oder Rechenzentren. Kubernetes erlaubt fein abgestufte Netzwerkregeln, Policies, Namespaces und Service-Typen, inklusive Integration in CNI-Plug-ins.
State Management und Persistenz:
Swarm behandelt Volumes eher stiefmütterlich. Es gibt keine native Unterstützung für StatefulSets oder StorageClasses. Kubernetes integriert Storage dynamisch, mit Provisionern, Bindings und Migrationsstrategien. Das ist entscheidend für datenintensive Anwendungen.
Security und Governance:
Swarm kennt Rollen und Token, aber keine granularen Rechte. Kubernetes setzt auf Role-Based Access Control (RBAC), Namespaces, ServiceAccounts und Policies, die genau definieren, wer was wo tun darf. Das ist in Enterprise-Umgebungen unverzichtbar.
Monitoring und Observability:
Swarm hat kein natives Monitoring. Logs und Metriken müssen extern gesammelt werden, ohne klar definiertes API- oder Plugin-Modell. Kubernetes bietet standardisierte Schnittstellen (Metrics API, Events, Probes) und Integrationen mit Tools wie Prometheus, Grafana, OpenTelemetry.
Diese Liste ließe sich fortsetzen. Sie zeigt jedoch bereits, dass Swarm kein reduziertes Kubernetes ist, sondern ein völlig anderes System – einfacher, ja, aber auch viel flacher.
Ein häufiger Grund, sich zunächst für Docker Swarm zu entscheiden, ist die Hoffnung auf eine sanftere Lernkurve. Und tatsächlich: Ein Swarm-Cluster ist in wenigen Minuten aufgesetzt. Ein paar Docker-Kommandos, und die ersten Services laufen verteilt über mehrere Nodes.
Doch dieser Vorsprung ist trügerisch.
Das Lernen von Swarm vermittelt kaum Wissen, das in Kubernetes wiederverwendbar wäre. Die Architektur, Terminologie und Konzepte unterscheiden sich so stark, dass ein späterer Umstieg praktisch ein Neuanfang ist. Wer also glaubt, mit Swarm den Einstieg in Container-Orchestrierung „vorzubereiten", täuscht sich selbst.
Swarm ist schnell zu verstehen, aber flach in seiner Tiefe. Kubernetes ist anfangs komplex, aber konsistent – wer einmal das Fundament verstanden hat, kann darauf alles Weitere aufbauen.
Viele Teams, die zunächst mit Swarm beginnen, stoßen nach kurzer Zeit an Grenzen: fehlende Netzwerktransparenz, unzureichendes Logging, manuelle Skalierung, kein Multi-Cluster-Support. Und sobald diese Punkte auftreten, müssen sie ohnehin auf Kubernetes migrieren.
Das Problem ist nicht, dass Swarm schlecht ist. Es ist nur zu klein für die Aufgaben, die Unternehmen typischerweise lösen wollen.
Unternehmen unterschätzen häufig die langfristigen Kosten falscher Technologieentscheidungen. Swarm zu wählen, weil es schneller eingerichtet ist, spart kurzfristig Schulungsaufwand – aber führt langfristig zu Mehraufwand durch Migration und Betrieb.
Ein Beispiel: Ein mittelständisches Unternehmen entscheidet sich, seine neuen Microservices mit Docker Swarm zu orchestrieren. Nach einem Jahr läuft alles stabil – bis man zentralisierte Authentifizierung, observability, Policy Enforcement oder automatisches Scaling benötigt.
Keines dieser Themen lässt sich in Swarm sauber lösen. Die Folge: Parallelbetrieb von Tools, individuelle Workarounds, zunehmende Komplexität. Schließlich entscheidet man, auf Kubernetes zu wechseln. Doch nun müssen Containerdefinitionen, Deployment-Strategien und CI/CD-Pipelines neu gebaut werden. Das Wissen aus Swarm hilft kaum.
Das vermeintlich einfache System wird so zum Umweg.
Kubernetes wirkt auf Neueinsteiger oft unnötig kompliziert. Es besteht aus vielen Komponenten, YAML-Definitionen, Konzepten und APIs. Doch diese Komplexität ist nicht Selbstzweck, sondern Ausdruck von Flexibilität und Sicherheit.
Kubernetes ist so gebaut, dass es unterschiedlichsten Anforderungen gerecht wird – von kleinen Inhouse-Systemen bis zu globalen Multi-Cloud-Plattformen. Es abstrahiert nicht nur Container, sondern auch Infrastruktur, Netzwerke, Identitäten und Policies.
Diese Modularität bedeutet, dass man in Kubernetes immer nur das nutzen muss, was man wirklich braucht. Wer einfach starten will, kann das tun. Wer später wachsen will, kann die gleiche Plattform weiterentwickeln.
Swarm hat diesen evolutionären Pfad nie bieten können.
In Unternehmens- oder Behördenumgebungen ist Governance kein „nice to have", sondern Voraussetzung. Es geht um Nachvollziehbarkeit, Sicherheit, Zugriffskontrolle und Regelkonformität.
Kubernetes ist darauf ausgelegt. Namespaces erlauben logische Trennung, RBAC steuert Zugriffe, Admission Controller setzen Richtlinien durch, und Audit Logs dokumentieren jede Aktion.
Docker Swarm kennt diese Mechanismen nicht in dieser Tiefe.
Wer sie braucht, muss sie selbst nachrüsten – was meist mehr Aufwand bedeutet als das Lernen von Kubernetes von Anfang an.
Gerade öffentliche Institutionen, die mit sensiblen Daten arbeiten, tun sich daher keinen Gefallen, wenn sie auf Swarm setzen. Die vermeintlich geringere Komplexität bedeutet hier schlicht fehlende Kontrolle.
Ein weiterer Punkt ist das Ökosystem. Kubernetes hat in den letzten Jahren eine Dynamik entwickelt, die Swarm nie erreicht hat. Nahezu alle modernen Infrastruktur- und DevOps-Tools – von Helm über ArgoCD bis zu OpenTelemetry – integrieren sich nativ in Kubernetes.
Swarm dagegen stagniert. Docker selbst hat den Fokus längst verschoben. Das meiste Innovationstempo findet heute in der Kubernetes-Community statt. Wer also auf Swarm setzt, entscheidet sich bewusst gegen die Richtung, in die sich die Branche bewegt.
Das ist nicht nur eine technische, sondern auch eine strategische Frage.
Trotz aller Kritik gibt es Szenarien, in denen Docker Swarm nach wie vor sinnvoll ist – vorausgesetzt, die Erwartungen sind klar definiert.
Für kleine Teams, die einfache Anwendungen betreiben, kann Swarm eine pragmatische Lösung sein. Wenn der Betrieb auf wenige Nodes beschränkt ist, keine komplexen Netzwerkregeln erforderlich sind und die Umgebung statisch bleibt, bietet Swarm einen leichten Einstieg.
Auch in Entwicklungsumgebungen, Testsystemen oder Lernumgebungen kann Swarm eine Rolle spielen. Es lässt sich schnell aufsetzen, verbraucht wenig Ressourcen und ist ideal, um Container-Grundlagen zu verstehen.
Doch sobald Wachstum, Skalierung oder Compliance relevant werden, endet diese Komfortzone.
Die Realität ist eindeutig: Früher oder später landen alle ernsthaften Swarm-Setups bei Kubernetes. Nicht, weil Kubernetes „hipper" ist, sondern weil es in der Lage ist, die Anforderungen moderner IT-Landschaften langfristig zu tragen.
Netzwerke werden komplexer, Security-Anforderungen steigen, Multi-Cloud-Strategien werden Standard, Automatisierung unverzichtbar. All das lässt sich mit Swarm nur umständlich oder gar nicht umsetzen.
Deshalb ist die Frage nicht „Swarm oder Kubernetes", sondern „Wie lange wollen wir Umwege gehen, bevor wir die Plattform einsetzen, die ohnehin kommen wird?"
Docker Swarm ist nicht schlecht. Es ist nur nicht das, was viele glauben, dass es sei. Es ist kein „Kubernetes light" und kein Einstiegspunkt in die Welt der Container-Orchestrierung. Es ist ein anderes Werkzeug, für ein anderes Problem, in einer kleineren Welt.
Wer heute neu in Container-Orchestrierung einsteigt, sollte das gesamte Bild sehen – inklusive der Lernkurve, der langfristigen Anforderungen und der organisatorischen Auswirkungen.
Kubernetes ist kein Hindernis, das man umgehen muss. Es ist eine Infrastruktur-Sprache, die sich zu lernen lohnt.
Bei ayedo begleiten wir Unternehmen, Behörden und Organisationen genau in dieser Entscheidungsphase. In unseren Workshops zu Docker, Kubernetes und Betriebssouveränität vermitteln wir nicht nur Tools, sondern Zusammenhänge: Wie Orchestrierung funktioniert, wie Betriebssicherheit entsteht und warum langfristige Entscheidungen über Technologie immer auch Entscheidungen über Souveränität sind.
Unsere Erfahrung zeigt: Wer den Schritt zu Kubernetes versteht, braucht keine Angst vor der Komplexität. Denn Komplexität ist nicht das Problem – Unwissen ist es.
Wir helfen Teams, die Brücke zu schlagen: von „es läuft irgendwie" zu „es läuft reproduzierbar, sicher und skalierbar". Und genau das ist der Unterschied zwischen einem Puzzle, das aussieht wie ein Pferd, und einem, das tatsächlich eines ist.
In vielen Gesprächen mit IT-Leitern, Sysadmins und Architekturverantwortlichen zeigt sich ein …
Kubernetes ist das Betriebssystem der souveränen Cloud Kaum eine Technologie hat die moderne IT so …
Wenn wir heute über digitale Souveränität und moderne IT-Infrastrukturen sprechen, führt kein Weg …