2025 Rückblick: Das Jahr, in dem sich die Softwareentwicklung wandelte
TL;DR Im Jahr 2025 erlebte die Softwareentwicklung einen grundlegenden Wandel, bei dem der Fokus von …
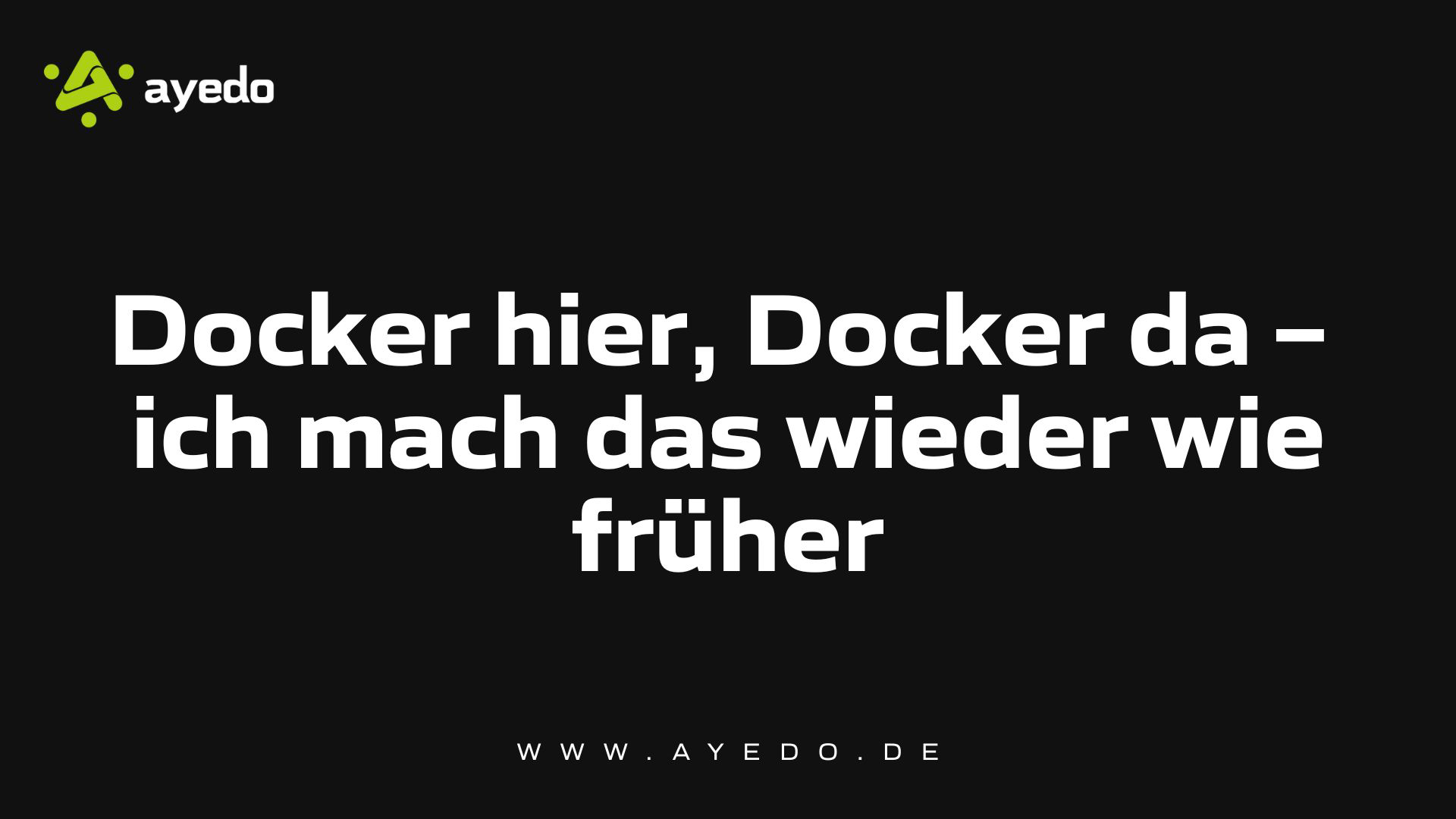
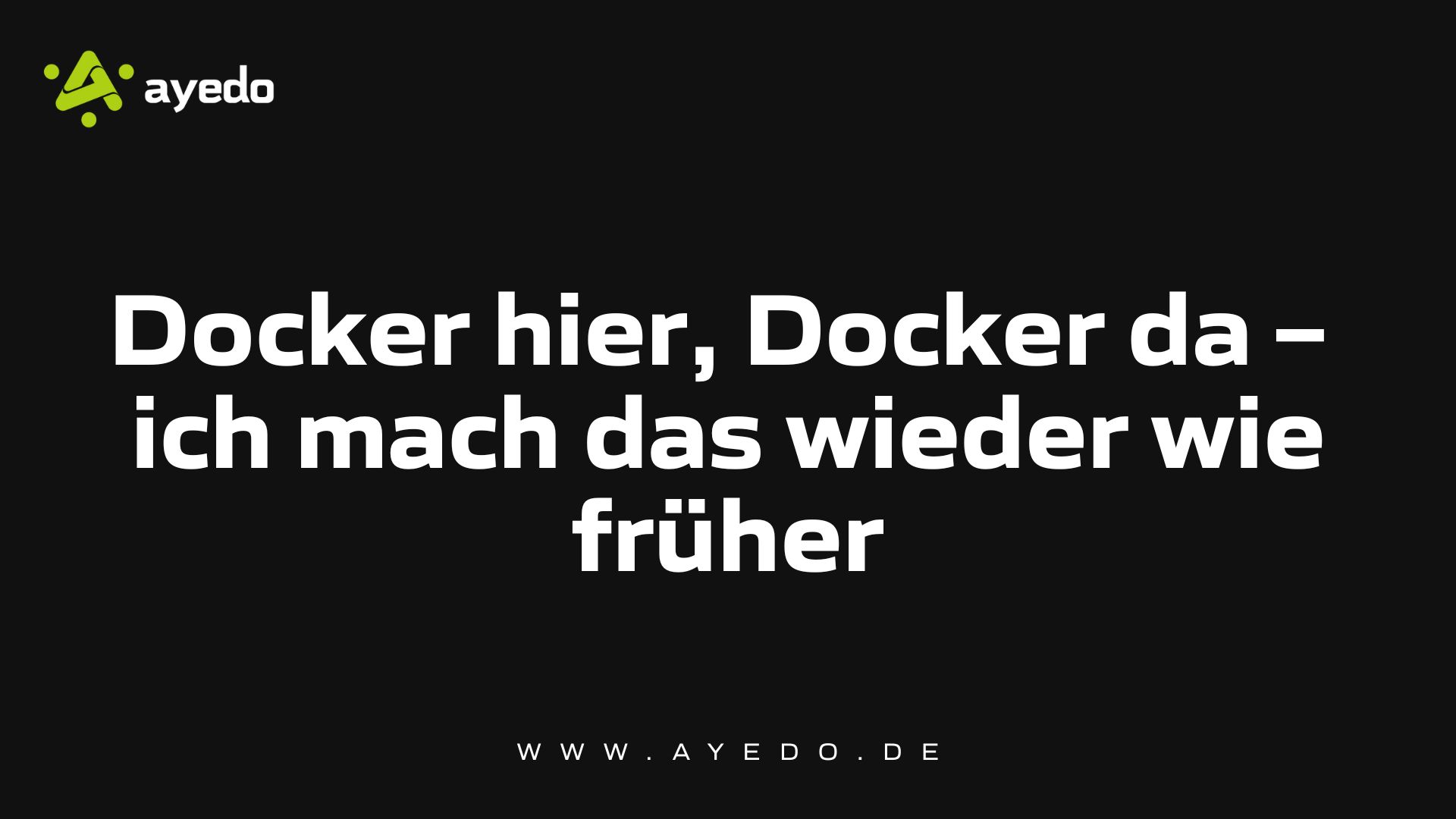
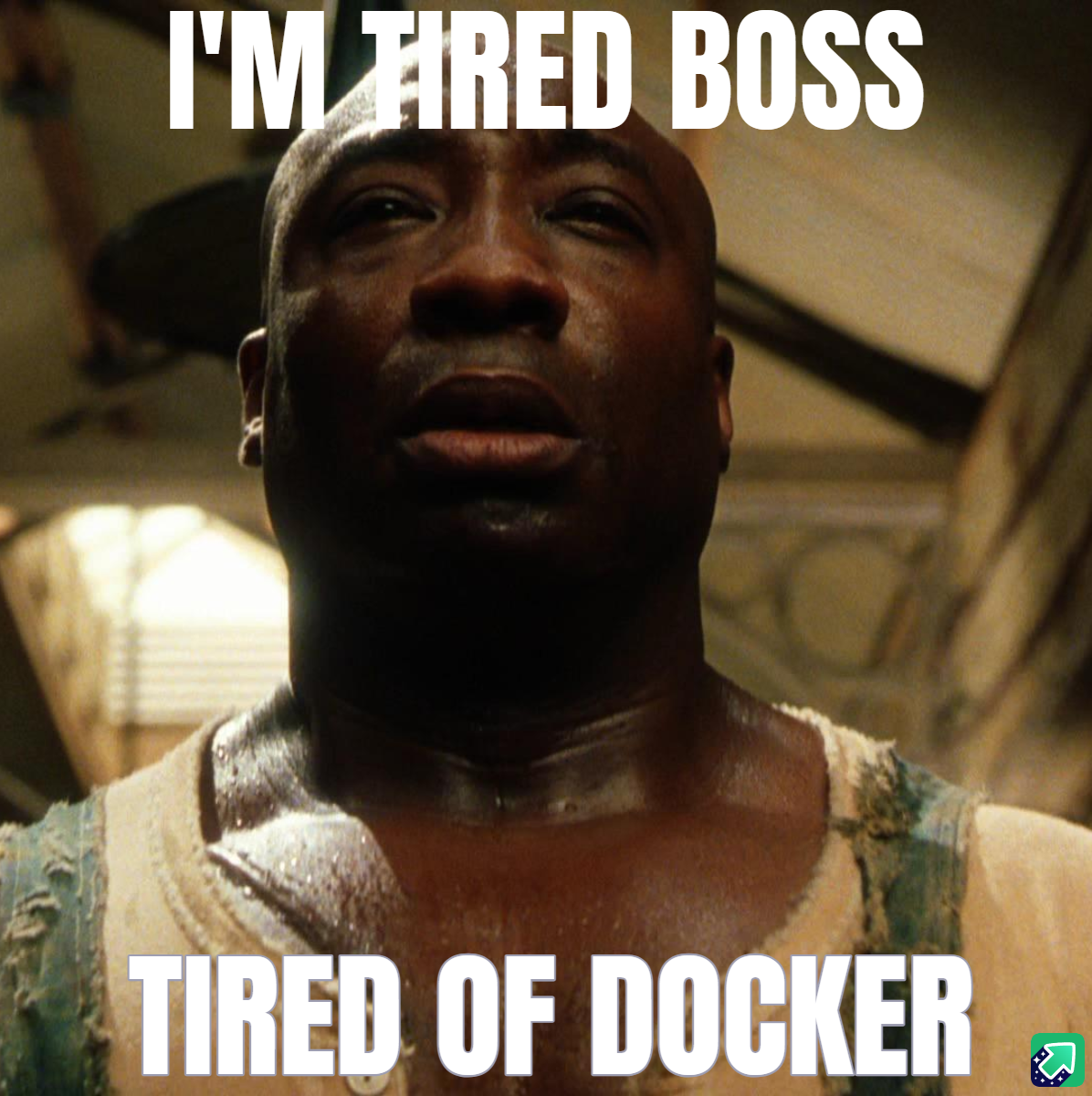
Man hört es immer öfter, halb ernst, halb genervt: „Docker hier, Docker da – ich mach das wieder wie früher."
Und wer’s sagt, meint meistens: Ich bin müde von der nächsten großen „Vereinfachung", die am Ende alles komplizierter macht. Wieder ein neues Tool, neue Begriffe, neue YAML-Dateien. Früher hat man einfach Software installiert. Ein apt install, ein service start, fertig.
Heute redet jeder von Images, Layern, Registries, Bind Mounts, Compose-Files, Netzwerken und Orchestrierung. Und klar – das wirkt erstmal nach mehr Aufwand.
Aber: Das ist keine Mode. Das ist Infrastruktur-Evolution. Und sie hat gute Gründe.
In der alten Welt war Software-Installation ein Abenteuer. Ein Entwickler veröffentlichte seine Anwendung – du hast dich durch kryptische Installationsanweisungen auf GitHub gearbeitet, ein Dutzend Abhängigkeiten installiert, Rechte gesetzt, Dienste konfiguriert. Vielleicht lief’s danach. Vielleicht auch nicht.
Die meiste Energie floss nicht in Betrieb oder Performance, sondern in Fehlerbehebung und Anpassung an lokale Systeme. Das Ergebnis:
Ein kleines Versionsupdate konnte ganze Systeme lahmlegen. Docker hat dieses Muster gebrochen. Statt „Software läuft nur auf meinem Server" heißt es heute: „Software läuft überall gleich."
Docker löst kein neues, sondern ein sehr altes Problem: Wie bekommt man Software zuverlässig von einem System auf ein anderes – ohne dass alles auseinanderfällt?
Die Antwort: Container.
Ein Container enthält alles, was eine Anwendung zum Laufen braucht – vom Code bis zu Abhängigkeiten. Das bedeutet:
Und das ist kein Selbstzweck. Es macht Software zugänglich.
In unseren Docker-Workshops bei ayedo erleben wir immer wieder das Gleiche: Viele Teilnehmende kommen aus klassischen Betriebs- oder Behördenstrukturen, nicht aus der DevOps-Welt. Und trotzdem – oder gerade deswegen – sind sie oft diejenigen, die den größten Mehrwert aus Containerisierung ziehen.
Warum? Weil Docker das Spielfeld öffnet.
Früher war die Bereitstellung einer neuen Anwendung ein IT-Projekt: mehrere Abteilungen, Budget, Freigaben, Testumgebungen, Betriebskonzept.
Heute reicht oft: ein Nachmittag, ein Compose-File, und jemand mit der Neugier, es einfach auszuprobieren.
Ein kommunaler IT-Bereich wollte seinen Bürgern ein einfaches Tool zur QR-Code-Erzeugung bereitstellen – ursprünglich als externes Softwareprojekt geplant, Aufwand: mehrere Wochen und ein fünfstelliges Budget.
Ein Mitarbeiter, Docker-affin aus seinem Homelab, fand ein Open-Source-Tool auf GitHub (natürlich in der awesome-selfhosted-Liste) und setzte es testweise in einem Container auf.
Ein Compose-File, ein Reverse Proxy, TLS über Let’s Encrypt – und die Anwendung lief stabil auf interner Infrastruktur. Nach einer Woche war das System produktiv.
Früher: Ausschreibung, Anbieter, Wartungsvertrag.
Heute: Eigeninitiative, Container, Eigenbetrieb.
Das passiert nicht selten. Ob Grafana für Monitoring, Paperless-NG für Dokumentenmanagement oder Pi-hole als interner DNS-Filter – überall entstehen durch Docker Lösungen, die früher kaum realisierbar gewesen wären.
Viele unterschätzen, was Homelabs in der modernen IT-Bildung bedeuten. Wer privat mit Docker experimentiert, lernt mehr über Systemarchitektur, Netzwerke, Security und Betrieb, als es viele formale Schulungen je vermitteln könnten.
Wir erleben regelmäßig, dass genau diese Leute in Unternehmen zu Multiplikatoren werden. Sie bringen produktionsreife Open-Source-Systeme ins Spiel, zeigen ihren Kolleg:innen, wie man sie betreibt – und verändern dadurch Kultur.
Docker ist nicht nur ein Werkzeug. Es ist eine Einstiegshürde mit eingebautem Belohnungseffekt: Wer es einmal verstanden hat, kann plötzlich alles betreiben.
Natürlich ist der Weg dahin nicht ohne Stolperfallen. Viele, die Docker neu kennenlernen, fühlen sich zunächst überfordert: Container, Images, Netzwerke – das klingt abstrakt. Aber genau deshalb ist es so wichtig, das Thema strukturiert zu lernen.
Man muss verstehen:
Ohne dieses Verständnis landet man schnell in einem Wust aus „funktioniert irgendwie, aber keiner weiß warum". Und das ist die Quelle vieler Frustrationen.
Sobald man das Grundprinzip verstanden hat, kippt die Perspektive. Plötzlich wird klar, warum Docker die Infrastruktur so nachhaltig verändert hat: Weil es nicht mehr Komplexität bringt – sondern die bestehende endlich sichtbar und beherrschbar macht.
Containerisierung zwingt dazu, Architektur bewusst zu gestalten. Sie belohnt sauberes Design, Trennung von Zuständigkeiten und Automatisierung.
Das klingt trocken – ist aber der Unterschied zwischen Betrieb und Betreiben.
Besonders spannend ist, wie Docker die Kluft zwischen Entwicklung und Betrieb geschlossen hat. Früher schrieb der Entwickler ein Handbuch – heute liefert er ein Image. DevOps wurde dadurch praktisch greifbar:
Damit ist Docker mehr als ein Tool – es ist ein gemeinsames Vokabular zwischen zwei Berufsgruppen, die jahrzehntelang aneinander vorbeigeredet haben.
Für Betriebsverantwortliche verändert Docker die Perspektive. Man denkt nicht mehr in Servern, sondern in Diensten. Nicht mehr in Installationen, sondern in Zuständen. Backup, Skalierung, Deployment – alles wird definierbar, nachvollziehbar, reproduzierbar.
Das mag anfangs ungewohnt wirken, aber genau darin liegt der Gewinn: Betrieb wird endlich planbar.
Gerade im öffentlichen Sektor und im Mittelstand ist Docker ein Türöffner. Was früher nur großen IT-Dienstleistern vorbehalten war, ist heute dank Containerisierung machbar: schnelle Bereitstellung von Services, sichere Trennung, geringere Betriebskosten und volle Kontrolle über Daten.
Wir sehen das bei Kommunen, Forschungsinstituten, Hochschulen und Unternehmen: Überall dort, wo Eigeninitiative entsteht, entstehen neue digitale Services – ohne monatelange Ausschreibungen, ohne komplexe Beschaffungsprozesse.
Docker ermöglicht digitale Souveränität.
Der Satz „Ich mach das wieder wie früher" ist verständlich. Aber er ignoriert, dass „früher" weder sicherer noch effizienter war. Die Zeiten, in denen man Server monolithisch aufgesetzt, Software manuell installiert und Konfigurationen händisch gepflegt hat, sind vorbei – nicht, weil sie schlecht waren, sondern weil sie nicht mehr skalieren. Docker zwingt uns, Systeme zu denken, nicht zu basteln. Das ist kein Rückschritt, sondern Reife.
Genau hier setzen unsere ayedo Docker-Workshops an. Wir arbeiten regelmäßig mit IT-Teams, Unternehmen und Behörden, die genau an diesem Punkt stehen: Docker wird überall erwähnt, erste Container laufen, aber das Verständnis fehlt.
Unsere Workshops vermitteln, was Containerisierung im Alltag wirklich bedeutet – aus Sicht des Betriebs. Wie Container-Architektur funktioniert, wie man sie sicher betreibt, wie Logging, Monitoring, Netzwerk und Security zusammenspielen.
Wir zeigen, wie man bestehende Workloads in Docker überführt, CI/CD integriert und dabei Stabilität behält. Kein Marketing, kein Overhead – nur echtes, praxisnahes Wissen.
Ja – Docker kann anstrengend sein. Aber wer einmal verstanden hat, was Containerisierung ermöglicht, wird sich nicht zurücksehnen nach der alten Welt der handgestrickten Installationen. Docker ist kein Trend. Es ist das Fundament moderner Infrastruktur. Und wer sich heute die Mühe macht, es zu lernen, profitiert morgen von einem Betrieb, der stabil, reproduzierbar und skalierbar ist. Also: nicht müde werden. Neugierig bleiben.
Danke Docker.
TL;DR Im Jahr 2025 erlebte die Softwareentwicklung einen grundlegenden Wandel, bei dem der Fokus von …
TL;DR Igor Aleksandrov, CTO und Mitgründer von JetRockets, teilt in einem Interview seine …
Viele Leute nicken wissend, wenn das Gespräch auf „Containerisierung" oder „virtuelle …