Weekly Backlog KW 46/2025
Editorial Digitale Souveränität war mal ein Technikthema. 2025 ist es Machtpolitik: Wer GPUs, …
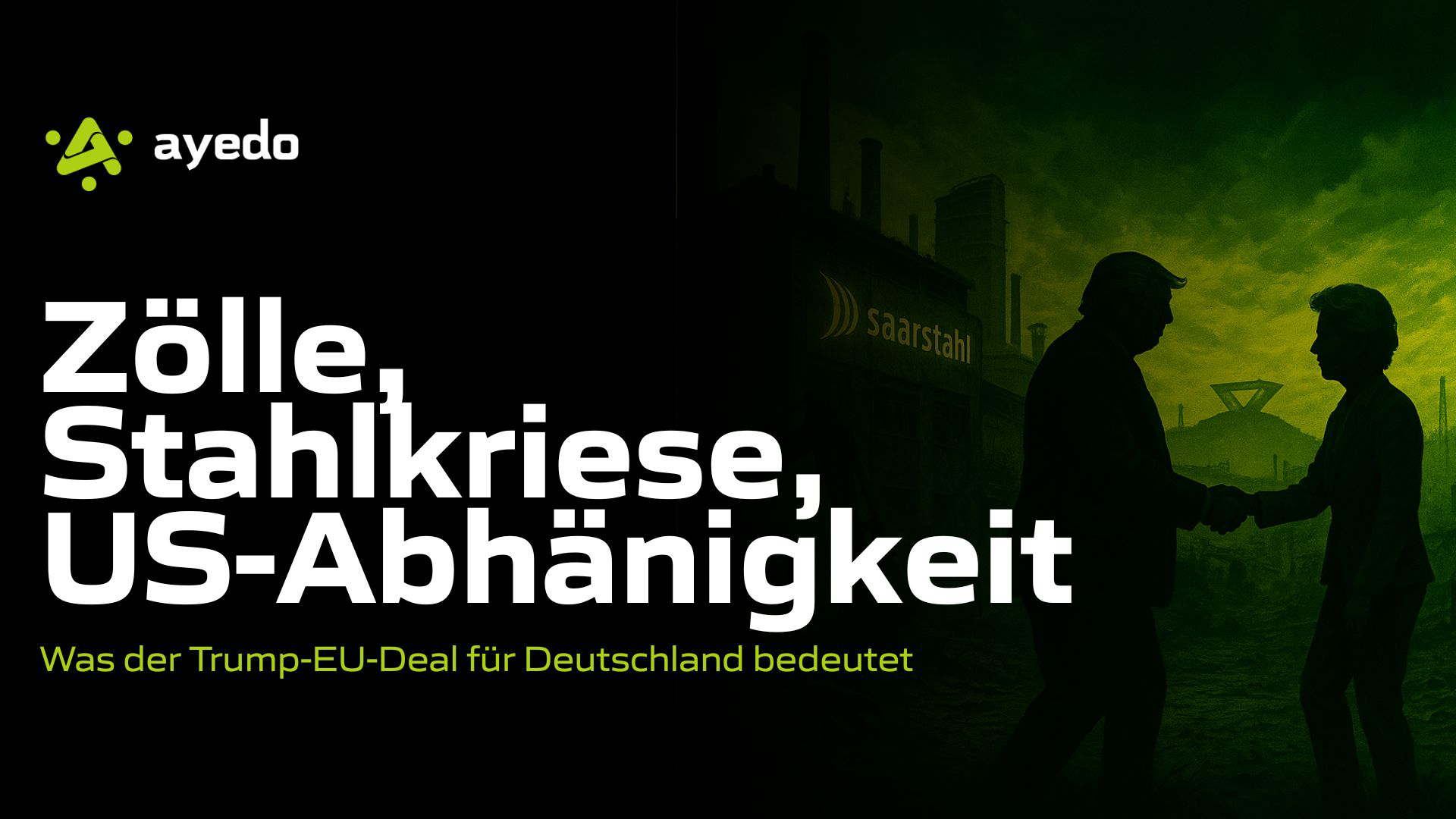
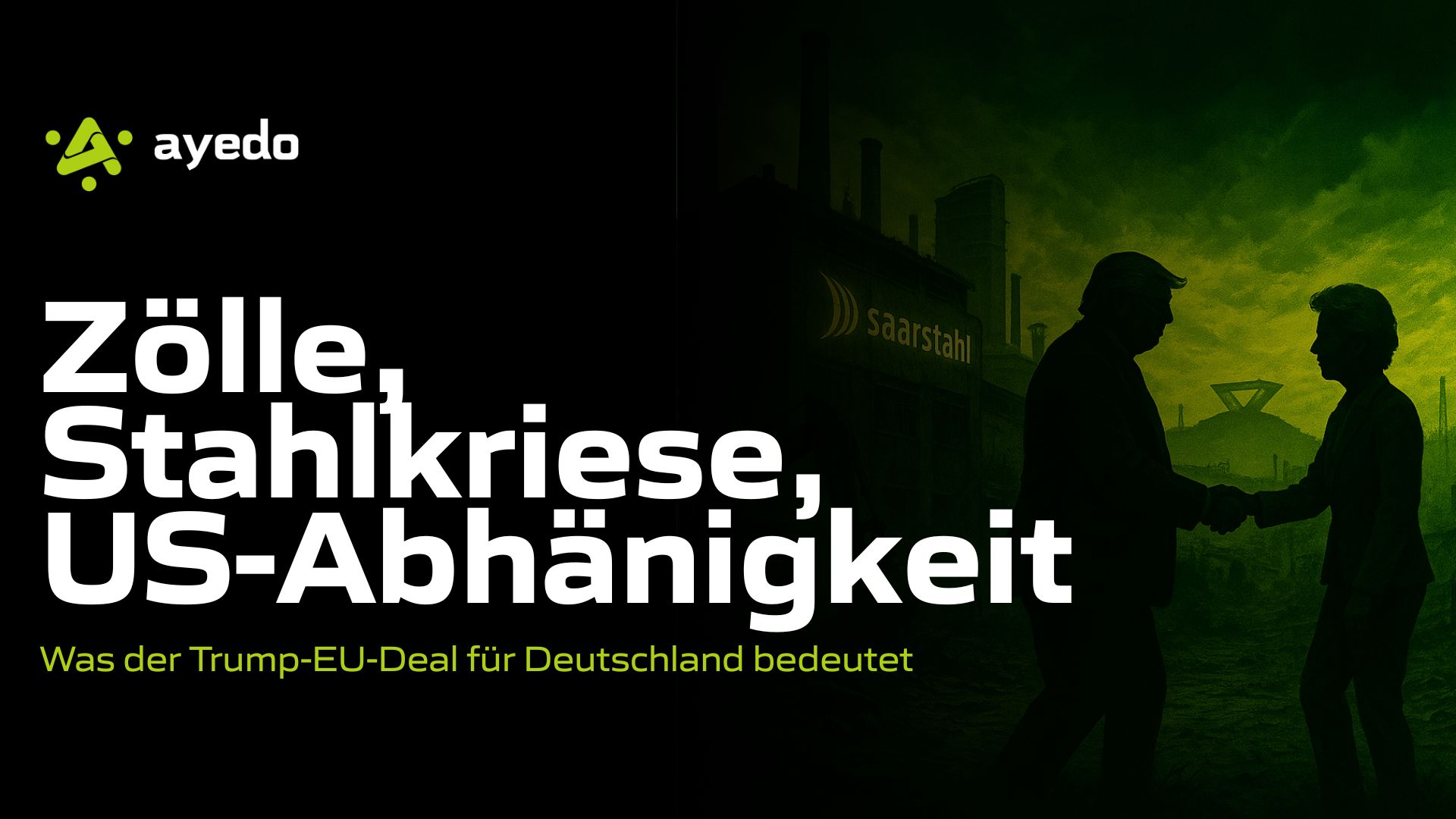
Es war ein langes Tauziehen – nun gibt es einen Deal. Die EU und die USA haben sich in letzter Minute auf einen Kompromiss im Zollkonflikt geeinigt. Was auf den ersten Blick wie ein geopolitischer Befreiungsschlag daherkommt, offenbart bei genauerem Hinsehen vor allem eines: Europa zahlt. Viel. Und nicht nur mit Geld.
Der neue Deal sieht vor, dass die ursprünglich angedrohten 30 % US-Zölle auf europäische Produkte abgewendet werden. Doch das ist kein Sieg – sondern der Preis für etwas anderes. Die EU akzeptiert nun einen pauschalen Einfuhrzoll von 15 % auf den Großteil ihrer Exporte in die USA. Für viele Güter – insbesondere Autos – bedeutet das eine Versechsfachung der bisherigen Zollsätze. Gleichzeitig bleibt der Zugang für US-Produkte in den europäischen Markt größtenteils zollfrei.
Diese Asymmetrie ist kein Detail. Sie ist das Ergebnis politischer Abhängigkeit und wirtschaftlicher Schieflagen, die sich über Jahre aufgebaut haben – und die in diesem Moment sichtbar werden. Das Gleichgewicht transatlantischer Handelsbeziehungen hat einen Knick bekommen. Nicht in Form eines Knalls, sondern im Sound nüchterner Zahlen.
Was zusätzlich irritiert: Die EU verpflichtet sich, bis zum Ende von Trumps Amtszeit amerikanische Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen – inklusive Flüssiggas, Öl und Uran. Parallel dazu sollen 600 Milliarden Dollar an Investitionen aus Europa in die USA fließen.
Man kann das als strategische Geste sehen. Oder als den endgültigen Abschied von dem Gedanken, wirtschaftliche Stärke auch im Inneren Europas zu festigen. Während Schulen, Brücken und digitale Netze in Deutschland verfallen, während über Bildungsgerechtigkeit und Infrastrukturmodernisierung seit Jahren nur geredet wird, verlagert sich ein riesiger Kapitalstrom über den Atlantik. Nicht als Ausdruck von Souveränität, sondern als Reaktion auf geopolitischen Druck.
Vor allem Deutschland steht in dieser Gleichung doppelt unter Druck: Die Stahlindustrie wird mit Zöllen von 50 % dauerhaft belegt. Ein strukturell angeschlagener Sektor, der ohnehin um Zukunftsinvestitionen ringt, verliert damit weiter an Wettbewerbsfähigkeit. Die Last trägt nicht nur die Branche – sie verteilt sich auf Arbeitsplätze, Wertschöpfungsketten und ganze Regionen.
Statt jedoch gegenzusteuern, folgt die öffentliche Beschaffung einem gefährlichen Trend: Investitionen in US-Technologien, auch im sicherheitskritischen Bereich. Plattformen wie Palantir, bekannt für ihre Nähe zu Nachrichtendiensten und ihren fragwürdigen Umgang mit Daten, erhalten Millionenverträge. Cloudlösungen von Amazon, Microsoft und Google dominieren den Markt für öffentliche IT-Infrastruktur – oftmals, obwohl europäische Alternativen bereitstünden.
Das Signal ist deutlich: Wir kaufen nicht nur amerikanische Energie, wir kaufen auch digitale Abhängigkeit. Die Entscheidung dafür fällt nicht unter Zwang. Sie fällt in Ministerien und Behörden, oft mit dem Argument der Effizienz, manchmal schlicht aus Bequemlichkeit.
Offiziell verkauft die EU den Deal als notwendigen Schritt zur Stabilisierung. Sicherheit in unsicheren Zeiten, so lautet die Formel. Doch es ist eine Form der Sicherheit, die auf Verzicht basiert: auf wirtschaftlicher Eigenständigkeit, auf politischer Verhandlungsstärke, auf einem klaren Bekenntnis zur eigenen Industrie.
Die Frage bleibt: Was wird bleiben – wenn das nächste Abkommen kommt, das nächste Machtungleichgewicht, der nächste wirtschaftliche Druck? Wird Europa dann erneut bereit sein, einen hohen Preis zu zahlen – nicht nur in Milliarden, sondern in strategischer Unabhängigkeit?
Der jüngste Deal mag kurzfristig Unsicherheiten abgewendet haben. Aber er hat etwas anderes zementiert: Dass wir unsere Interessen oft zu leise, zu vorsichtig und zu spät formulieren.
Editorial Digitale Souveränität war mal ein Technikthema. 2025 ist es Machtpolitik: Wer GPUs, …
Kubernetes Make or Buy – Denkanstöße für Entscheider In kaum einem anderen Technologiebereich wird …
Der Fall Localmind: Was passiert, wenn Sicherheitsversprechen nicht eingelöst werden Die …