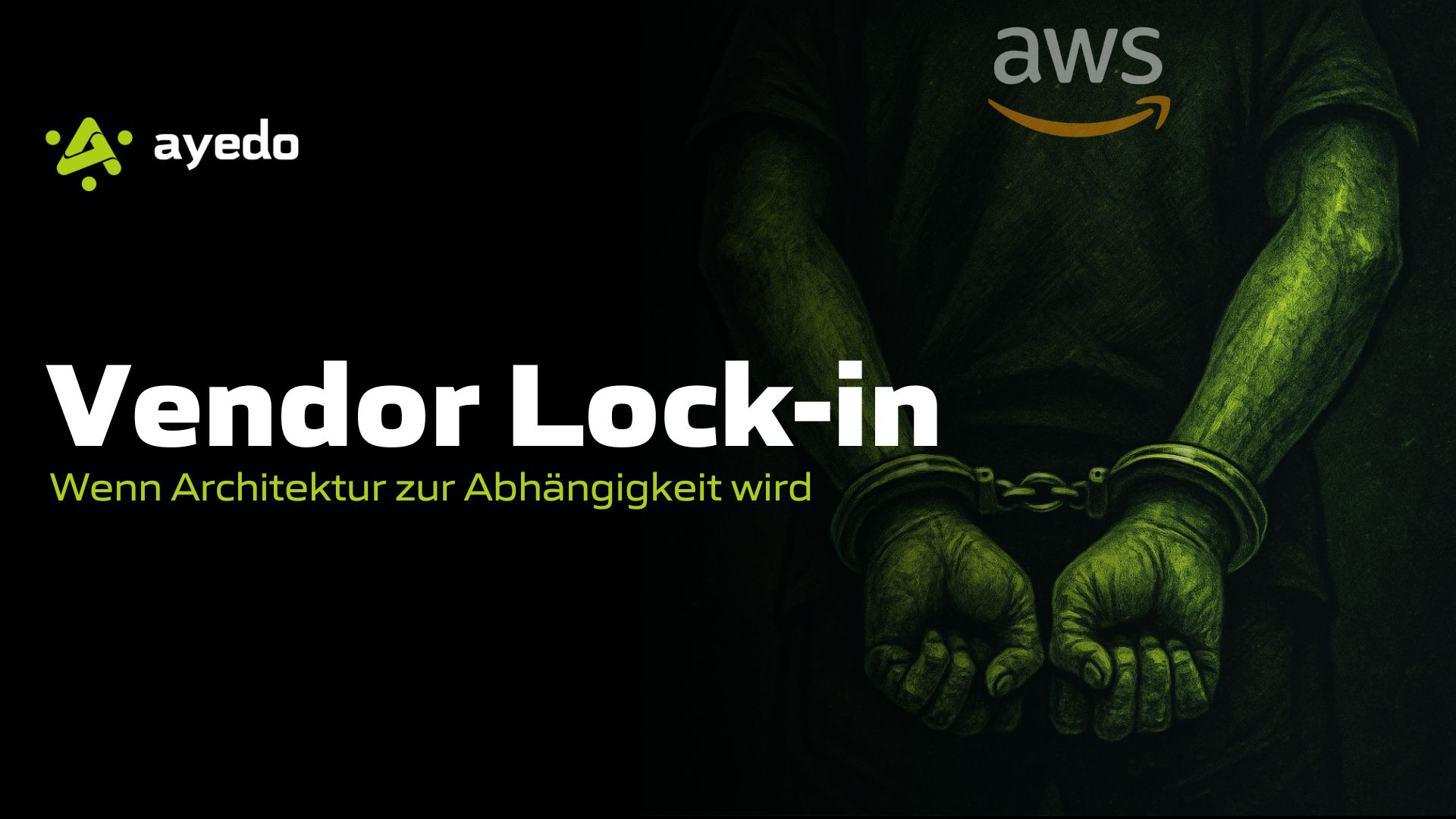
Vendor Lock-in – Wenn Architektur zur Abhängigkeit wird
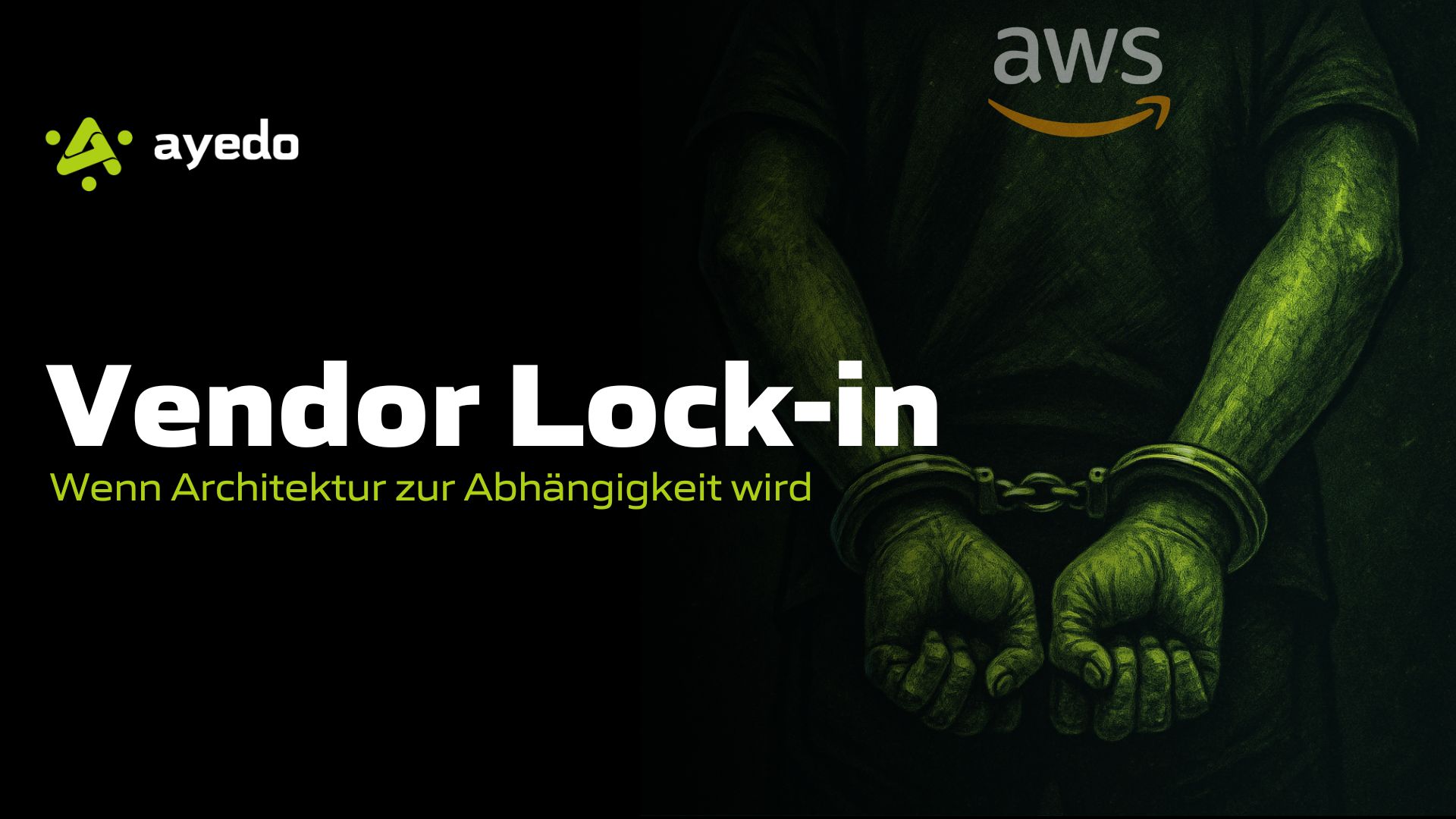
Vendor Lock-in bezeichnet die technisch, wirtschaftlich oder rechtlich eingeschränkte Fähigkeit, einen IT-Dienstleister oder Plattformanbieter ohne erheblichen Aufwand zu wechseln.
Anders gesagt: Du könntest in der Theorie gehen – aber praktisch ist es keine Option mehr.
Diese Abhängigkeit entsteht nicht über Nacht. Sie wächst schleichend.
Ein Managed Service hier, ein Auth-System dort, etwas Monitoring, ein wenig IAM. Alles greift ineinander, alles funktioniert reibungslos. Bis du irgendwann feststellst: Dein gesamter Stack ist untrennbar mit genau einem Anbieter verbunden.
Und jetzt? Jeder Wechsel bedeutet Zeit, Geld, Re-Architektur.
Also bleibst du. Und genau darauf basiert das Geschäftsmodell.
Warum Lock-in so gefährlich ist
Das Problem am Lock-in ist nicht, dass ein Dienst schlecht wäre. Viele Plattformservices sind technisch stark.
Das Problem ist: Du gibst Kontrolle ab – oft, ohne es zu merken. Und du bekommst sie nicht zurück, wenn es drauf ankommt.
- Preisgestaltung ändert sich? Du schluckst es.
- Regionale Compliance-Anforderungen ändern sich? Du wartest auf das nächste Service-Update.
- Ein kritischer Fehler muss in einem Kernsystem gepatcht werden? Du bist auf die Pipeline deines Providers angewiesen.
Was du verlierst, ist nicht nur Flexibilität. Du verlierst strategische Beweglichkeit – und das in einem Umfeld, das sich ständig ändert.
Kontrollierte Architektur vs. Vendor Lock-in
| Eigenschaft | Kontrollierte Architektur | Vendor-Lock-in |
|---|---|---|
| Systemwechsel möglich? | Mit überschaubarem Aufwand | Nur mit hoher Investition oder Downtime |
| Abhängigkeit von APIs | Standardisiert, austauschbar | Proprietär, nicht portierbar |
| Plattformbindung | Lose Kopplung | Tief integriert in Betriebslogik |
| Kontrolle über Daten | Eigene Backup- & Recovery-Verfahren | Eingeschränkt durch Plattformvorgaben |
| Anpassung an neue Vorgaben | Schnell und intern steuerbar | Nur über Feature-Roadmap des Anbieters |
Technisch ist der Unterschied oft nicht sichtbar – bis du migrieren musst. Oder den Anbieter wechseln willst. Oder schlicht nicht bereit bist, auf die nächste Policy-Änderung des Providers zu reagieren, ohne dass sie dein gesamtes System betrifft.
Lock-in ist keine technische Notwendigkeit
Die Wahrheit ist: Die meisten Lock-ins sind selbst gemacht.
Sie entstehen durch Bequemlichkeit, durch Tooling, durch das unreflektierte Vertrauen in “Managed” und “as-a-Service”-Versprechen.
Aber: Jeder proprietäre Dienst, der sich tief in Architektur, Monitoring, Logging, Authentifizierung oder Datenhaltung einschreibt, ist ein strategischer Anker. Je mehr du davon hast, desto schwerer wirst du – im denkbar ungünstigsten Moment.
Vendor Lock-in ist kein Bug. Es ist ein Feature. Und zwar eins, das sehr lange unauffällig bleibt – bis du es verlierst: Kontrolle.
Fazit:
Du musst nicht alles selbst betreiben. Aber du solltest alles jederzeit selbst betreiben können.
Wenn du darauf keine klare Antwort hast, hast du kein System. Du hast ein Abonnement.
Wie man digitale Souveränität zurückgewinnt und warum Cloud Exit für viele Unternehmen zur echten Option wird, erfahren Sie in unseren weiterführenden Artikeln.