Was bedeutet eigentlich „Digitale Souveränität" – ganz konkret?
Digitale Souveränität bezeichnet die Fähigkeit einer Organisation, ihre digitalen Systeme, …
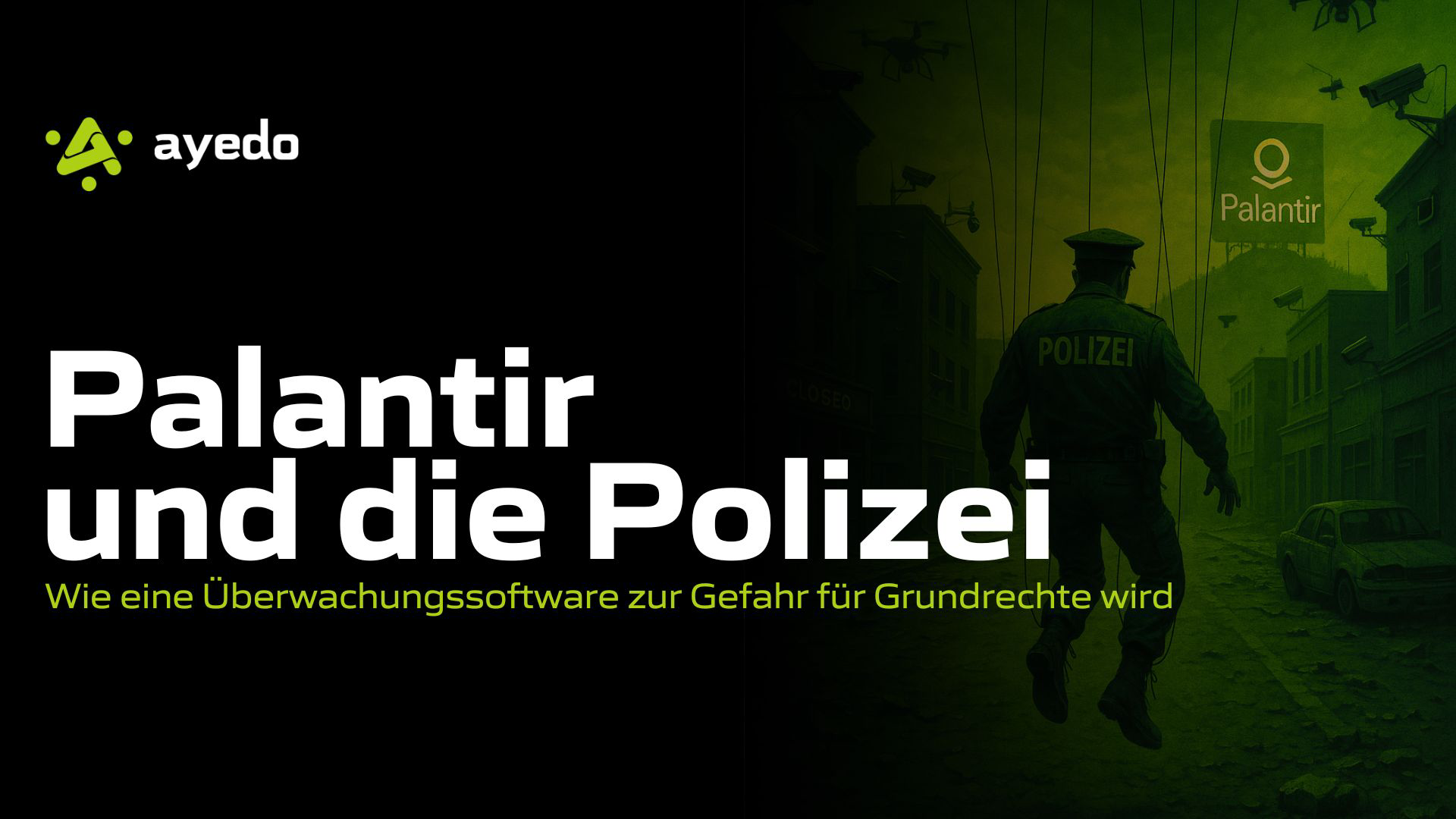
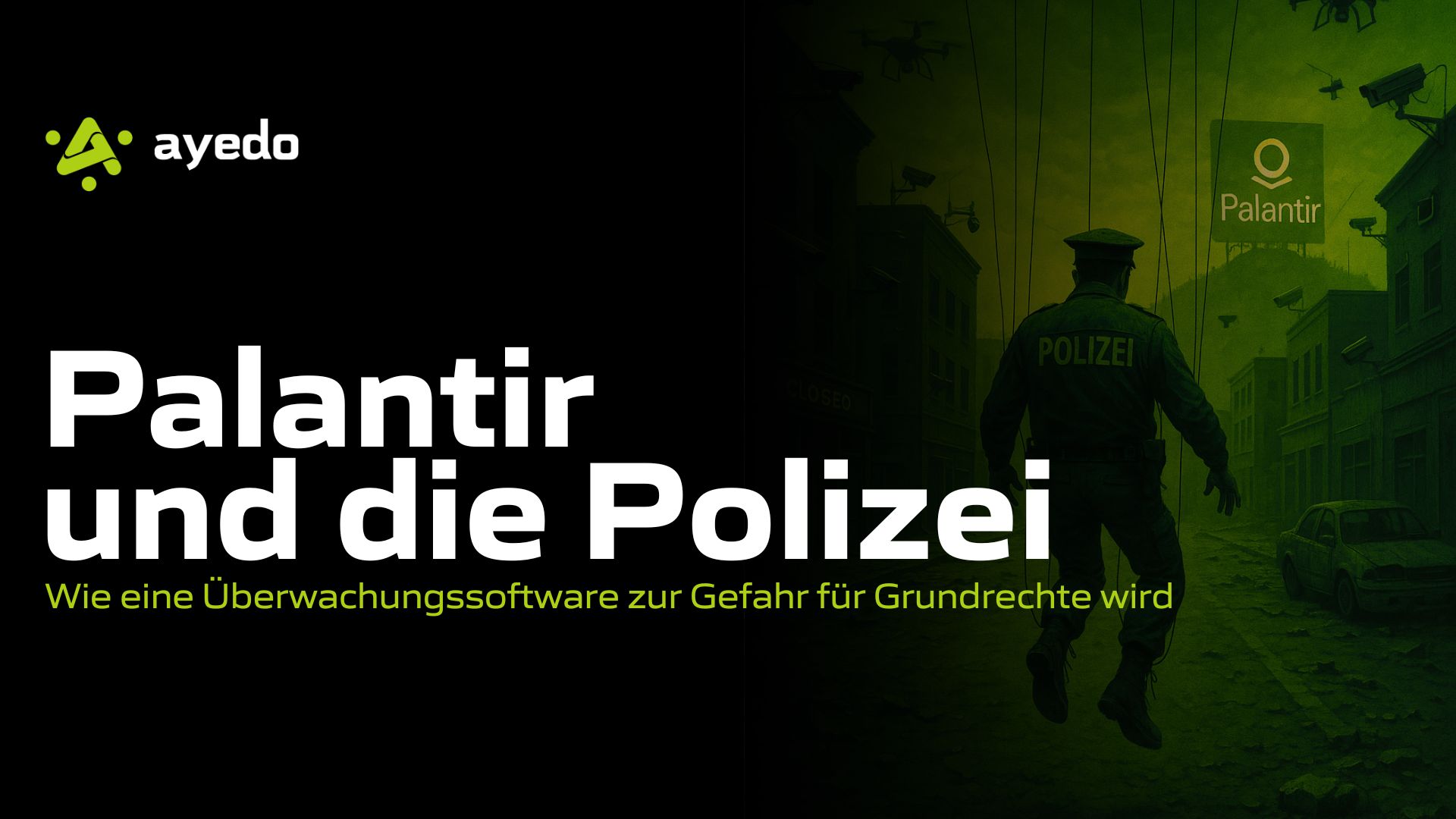
Palantir in Deutschland ist mehr als nur ein Softwareanbieter. Es ist das Symbol für einen stillen Wandel im Staat: Weg von demokratischer Kontrolle, hin zu datengetriebener Überwachung durch externe Tech-Konzerne. Und mittendrin – deutsche Innenministerien, die Millionen ausgeben für ein System, das sie weder verstehen noch kontrollieren.
In Hessen wurde ein Vertrag mit Palantir Technologies abgeschlossen, der die Landesregierung rund 400.000 Euro pro Monat kostet – über fünf Jahre hinweg. Ohne öffentliche Ausschreibung. Ohne parlamentarische Kontrolle. Und ohne produktiven Einsatz. Denn die Einführung der Überwachungssoftware Gotham wurde gestoppt, nachdem das Bundesverfassungsgericht 2023 zentrale Regelungen für verfassungswidrig erklärt hatte.
Trotzdem setzt Bayern nun auf genau diese Software – und damit auf ein System, das automatisiert Daten aus verschiedensten Polizeiquellen zusammenführt und analysiert.
Palantirs Software verknüpft Daten aus:
Was dabei entsteht, ist ein vollständiges digitales Profil – auch von Menschen, die nie unter Verdacht standen: Zeugen, Anwälte, Ärzte, Journalisten. Wer einmal erfasst wurde, kann künftig mitgerastert werden. Die Grenze zwischen Ermittlungsarbeit und Generalverdacht verwischt.
Die Palantir-Plattform ist eine Blackbox. Es gibt keine Einsicht in den Quellcode, keine öffentlich zugängliche technische Dokumentation, keine nachvollziehbare Entscheidungslogik. Die Behörden wissen nicht, wie Gotham Daten gewichtet oder kombiniert. Dennoch verlassen sie sich auf seine Vorschläge.
Diese technologische Intransparenz gepaart mit Vendor Lock-In (einmal eingeführt, kaum wieder ablösbar) macht aus einem Tool ein Systemrisiko – strategisch, rechtlich und demokratisch.
Palantir ist ein US-Unternehmen. Und damit unterliegt es dem Cloud Act – einem US-Gesetz, das US-Behörden Zugriff auf Daten einräumt, selbst wenn diese außerhalb der USA gespeichert sind. Das bedeutet: Es gibt keine Garantie, dass personenbezogene Daten aus Deutschland nicht in Washington landen.
Auch wenn Palantir beteuert, sich an EU-Recht zu halten – rein juristisch ist das nicht ausreichend. Der Zugriff kann erfolgen, ohne dass deutsche Behörden dies verhindern oder auch nur bemerken.
Peter Thiel, Mitgründer und Großaktionär von Palantir, ist kein neutraler Unternehmer. Er steht für einen rechts-libertären Kurs, sympathisiert offen mit autoritären Regimen und sieht in demokratischen Prozessen vor allem ein Effizienzproblem.
Auch CEO Alexander Karp äußerte mehrfach, dass Technologie sich nicht auf politische Prozesse warten dürfe. Palantir wurde mit Geldern des CIA-nahen In-Q-Tel-Fonds aufgebaut und arbeitete eng mit dem US-Militär und Geheimdiensten zusammen.
Die Debatte um Palantir ist nicht nur eine technische. Es geht um Demokratie, Rechtsstaat und die Frage, wem wir in der digitalen Verwaltung vertrauen. Der Einsatz von Palantir in der Polizei ist keine bloße Softwareentscheidung – es ist ein Strukturwandel im Verhältnis zwischen Bürger und Staat.
Wer Grundrechte für Datenverknüpfung opfert, riskiert langfristig das Vertrauen in staatliche Institutionen. Und wer dabei auf undurchsichtige, ausländische Technologiekonzerne setzt, gibt Kontrolle ab – nicht nur technisch, sondern politisch. Europäische Cloud-Alternativen bieten hier transparente und DSGVO-konforme Lösungen.
Digitale Souveränität bezeichnet die Fähigkeit einer Organisation, ihre digitalen Systeme, …
Eine kritische Analyse zur digitalen Souveränität in Deutschland und der Schweiz Während …
Nextcloud souverän betreiben: Warum das „Wie“ entscheidend ist Nextcloud steht für digitale …