Compliance Compass: EU-Regulierungen für Software, SaaS und Cloud-Hosting
TL;DR Die EU hat mit GDPR, NIS‑2, DORA, CRA, Data Act und dem Cloud Sovereignty Framework ein …

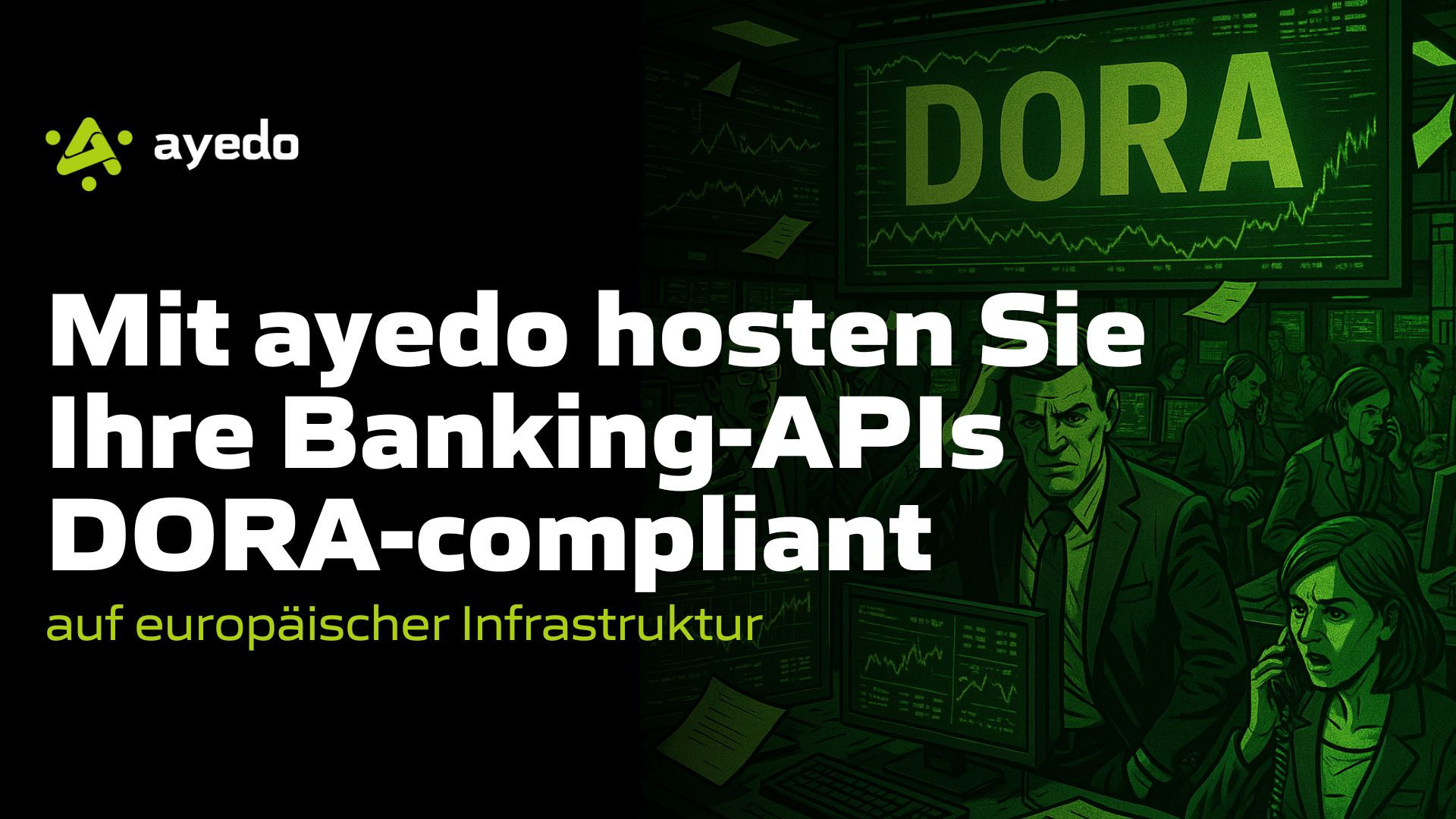
DORA kommt. Und diesmal bleibt es nicht bei ein paar hübschen Compliance-PDFs.
Was viele Banken, Zahlungsdienstleister und FinTechs gerade erst realisieren:
DORA (Digital Operational Resilience Act) ist kein weiteres Dokumentations- und Prüfverfahren, das man durch ein paar Policies und Zertifikate elegant beilegt. DORA greift deutlich tiefer in den operativen Betrieb ein.
Es geht um technische Resilienz. Nicht auf PowerPoint-Ebene, sondern direkt in der Infrastruktur.
Der eigentliche Kern von DORA: Die vollständige Kontrolle über Betriebsfähigkeit und Störungsresilienz kritischer IT-Systeme. Also genau das, was klassische SaaS- oder Public-Cloud-Modelle ungern im Detail offenlegen.
Sobald APIs, Plattformen oder Schnittstellen im Zahlungsverkehr operativ laufen, greift DORA an mehreren Punkten:
Hier geht es nicht um hübsche Logfiles und monatliche Verfügbarkeitsstatistiken.
Hier geht es darum, jederzeit detailliert nachweisen zu können, wer wann auf welche Systeme zugreift, wer wo deployed, wer welche Konfiguration ändert — und was passiert, wenn ein System an der Kante wirklich ausfällt.
Viele bauen ihre Banking-APIs aktuell auf generischen Public-Cloud-Plattformen. Schön skalierbar, bequem, vermeintlich sicher.
Aber DORA interessiert sich nicht für Skalierung. DORA interessiert sich für Transparenz, Steuerbarkeit und vollständige Auditierbarkeit.
Wer kann auf das Control Plane zugreifen?
Wer betreibt die Schlüsselverwaltung?
Wer managed das Service Mesh?
Wer kann im Fehlerfall Systeme restarten oder Failover erzwingen?
Wenn all das außerhalb der eigenen Verantwortung liegt (oder bei global agierenden Plattformanbietern zentralisiert ist), wird’s schnell eng, sobald DORA-Audits tiefer reingehen.
Die regulatorische Verantwortung bleibt bei den Banken und Zahlungsdienstleistern. Nicht beim Hoster. Nicht beim Plattformanbieter. Und spätestens ab 2025 wird die Verantwortung dafür scharf geprüft.
Genau hier braucht es Infrastruktur, die operativ nachvollziehbar bleibt.
Europäische Gerichtsbarkeit. Klare Betriebsprozesse. Kein externer Zugriff auf Control Plane-Komponenten. Keine juristische Grauzone durch außereuropäische Rechtssysteme.
Wir betreiben Infrastruktur für genau diese Szenarien:
Das ist nicht mehr optional. Das ist die technische Grundlage, um regulatorisch stabil durch die kommenden Jahre zu kommen.
DORA verschiebt die Verantwortung dorthin, wo sie hingehört: in den operativen Betrieb.
Wer Banking-APIs heute noch auf Plattformen laufen lässt, die er nur oberflächlich versteht und nicht vollständig steuern kann, wird spätestens im Audit erklären müssen, wie er Resilienz und Compliance eigentlich operationalisiert.
Sichere APIs fangen nicht beim TLS-Zertifikat an. Sie fangen in der Infrastruktur an, die man selbst kontrolliert.
Und genau dafür haben wir den Stack gebaut.
Weitere Einblicke in strukturierte Compliance-Ansätze und ISO-Zertifizierungen zeigen, wie systematische Herangehensweisen langfristig zum Erfolg führen. Für Unternehmen, die digitale Souveränität ernst nehmen, bieten europäische Kubernetes-Plattformen die notwendige Kontrolle und Transparenz.
TL;DR Die EU hat mit GDPR, NIS‑2, DORA, CRA, Data Act und dem Cloud Sovereignty Framework ein …
Wie der KI-Service Desk der Bundesnetzagentur Unternehmen in die Zukunft begleitet Die europäische …
CVE-Aus abgewendet – doch Europa geht eigene Wege. Mit der neuen Schwachstellendatenbank der ENISA …