Weekly Backlog KW 7/2026
Editorial: Diese Woche hat vor allem eines gezeigt: Digitale Souveränität ist kein Strategiepapier, …
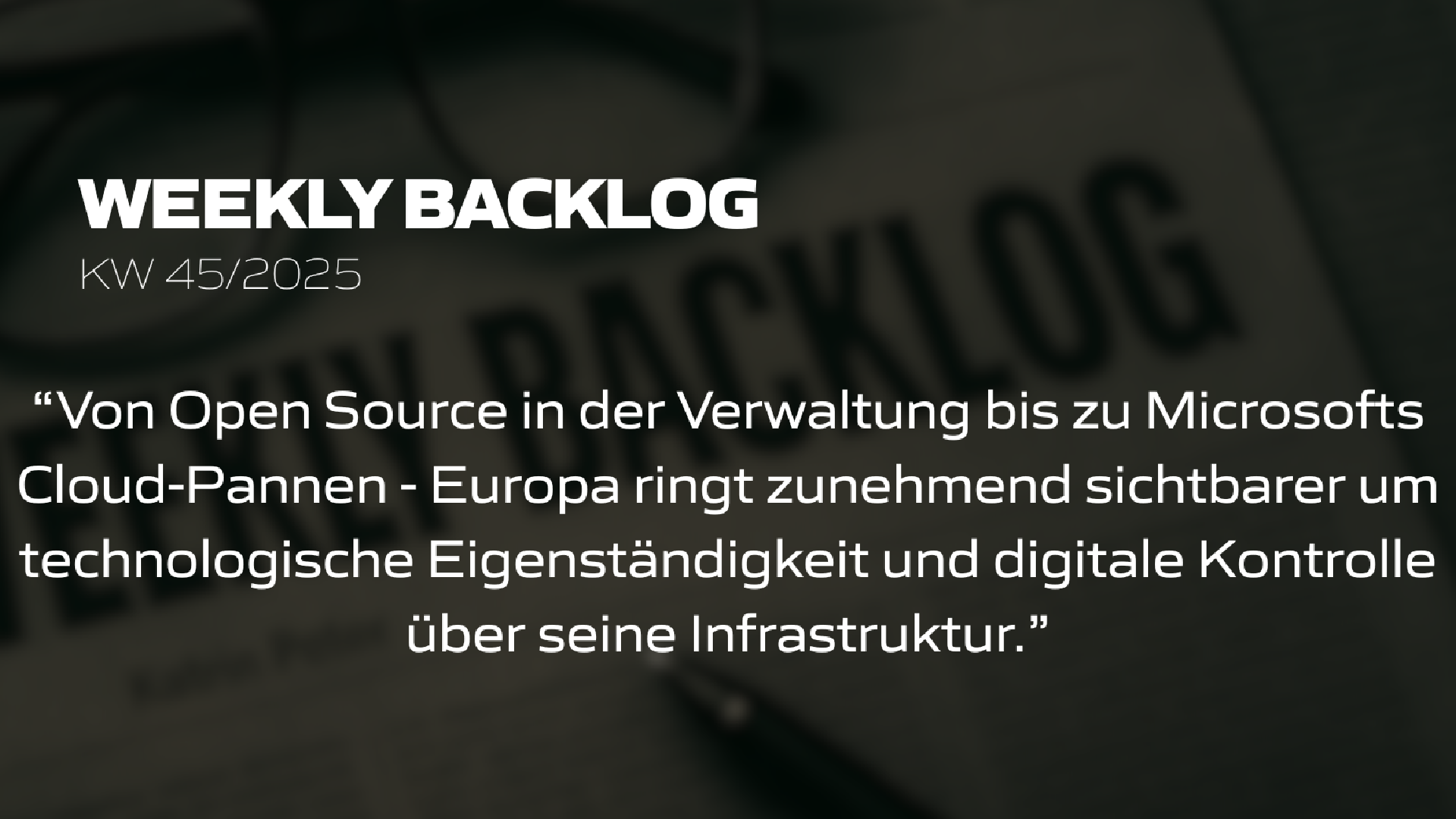
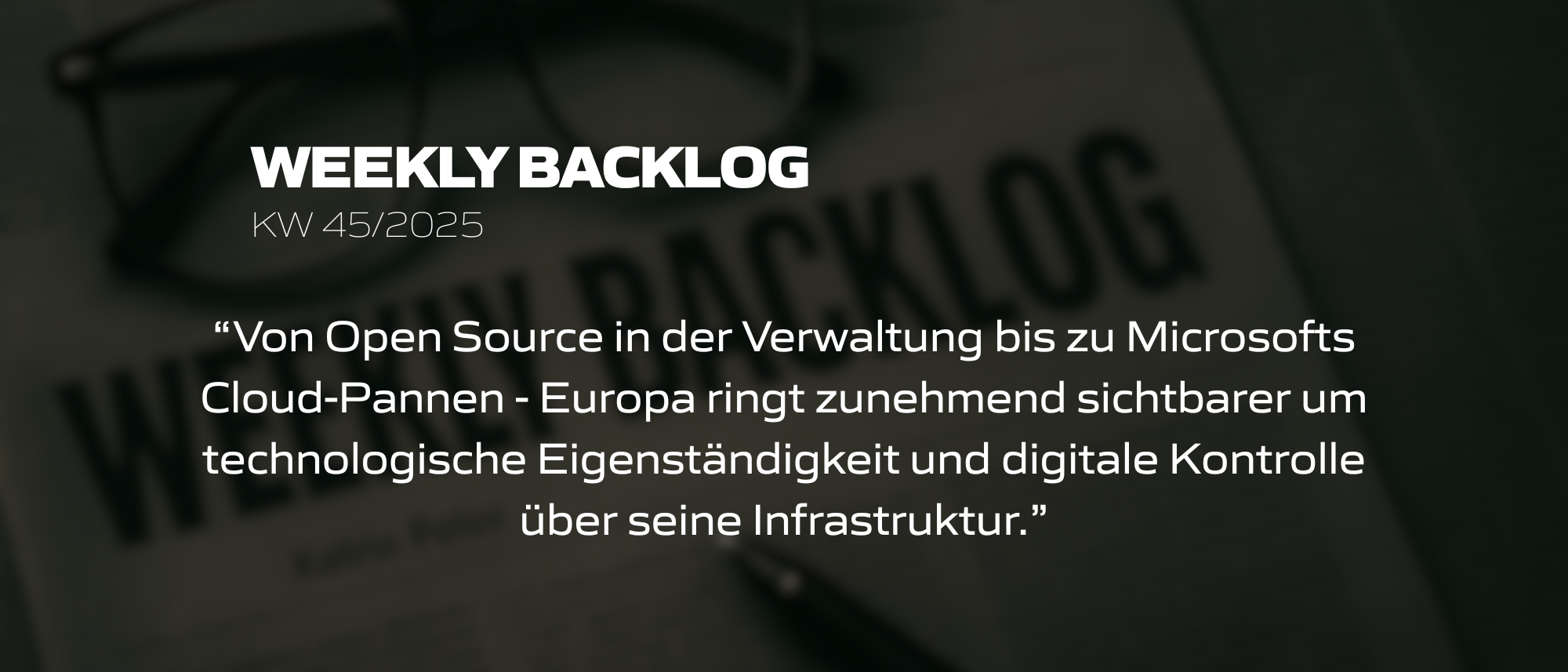
Europa entdeckt, dass digitale Unabhängigkeit kein Ideal ist, sondern ein Wartungsfall.
In dieser Woche hatte die digitale Souveränität gleich mehrere Bühnen. Von der Verwaltung über die Forschung bis zur Justiz. Während Microsofts DNS-Probleme die halbe Infrastrukturen ausknockt, feiert das Bundesministerium für Digitales seinen TYPO3-Erfolg als Symbol staatlicher Emanzipation. Die DFG zieht Daten aus US-Clouds, der Internationale Strafgerichtshof ersetzt Microsoft durch OpenDesk, und die Industrie ruft „Stop the clock", um beim AI Act Zeit zu gewinnen.
Es ist, als würde Europa gleichzeitig versuchen, sich aus drei Jahrzehnten Bequemlichkeit zu befreien - mit Werkzeugen, die es selbst erst noch bauen muss.
Wenn Behörden plötzlich Open Source feiern, sollte man kurz prüfen, ob man träumt. Doch der Government Site Builder 11 (GSB 11) zeigt, dass sich im Apparat etwas bewegt. Auf der Smart Country Convention gewann das vom BMDS und ITZBund entwickelte System gleich doppelt - und das völlig zurecht.
Der GSB basiert auf TYPO3, ist modular, dokumentiert und vor allem: wiederverwendbar. Das klingt banal, ist aber revolutionär in einem Umfeld, in dem jede Kommune ihr eigenes CMS bezahlt, weil die alte Lösung „nicht kompatibel" war.
Dass Schleswig-Holstein gleichzeitig für seine konsequente Open-Source-Strategie ausgezeichnet wurde, fügt sich nahtlos ein: Es ist das erste Bundesland, das nicht mehr über Souveränität redet, sondern sie konfiguriert.
Stark!
🔗 Linux-Magazin zur Auszeichnung
Ein Konfigurationsfehler im Microsoft-CDN „Front Door" reicht, um Outlook, Office 365, Azure und Xbox weltweit lahmzulegen. Der Konzern nennt es eine „Fehlkonfiguration", ich nenne es Abhängigkeit.
Die Vorstellung, dass ein amerikanischer Anbieter durch einen DNS-Fehler europäische Unternehmen, Verwaltungen und Bildungseinrichtungen lahmlegt, wäre vor zehn Jahren noch als Science-Fiction durchgegangen. Heute ist sie bitterer Alltag.
Microsofts Reaktion ist symptomatisch: vage Statusmeldungen, technische Ausweichratschläge, die Sicherheitskonzepte aushebeln. Das Problem ist nicht der Fehler. Sondern die Architektur dahinter.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) beginnt, Forschungsdaten aus US-Clouds zurückzuholen - eine Entscheidung, die weniger mit IT, sondern mit Geopolitik zu tun hat.
Der US Cloud Act erlaubt amerikanischen Behörden den Zugriff auf Daten, die bei US-Unternehmen liegen. Egal, ob diese in Deutschland oder sonst wo gespeichert sind. Damit wird Forschung zum juristischen Risiko. Die DFG will das ändern und finanziert den Umzug in europäische Infrastrukturen wie die European Open Science Cloud (EOSC).
Das ist ein Paradigmenwechsel: Zum ersten Mal geht es nicht um Datensicherheit im technischen Sinn, sondern um Souveränität als Forschungsbedingung.
Die Erkenntnis, dass Wissen nur dann frei ist, wenn es unter eigener Kontrolle steht, kommt spät - aber immerhin kommt sie.
🔗 heise online zur DFG-Initiative
Die europäische Industrie entdeckt ihre Liebe zur Langsamkeit. Unter dem Motto „Stop the clock" fordern IBM, Siemens und der BDI, die Umsetzung des AI Act um bis zu zwei Jahre zu verschieben. Angeblich, weil Standards fehlen.
Tatsächlich geht es um etwas anderes: Zeit gewinnen, um Compliance zu umgehen. Denn der AI Act verlangt Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Dokumentation. Das sind alles Dinge, die in der Industrie nicht aus technischen, sondern aus kulturellen Gründen schwerfallen.
Dass IBM selbst an den Standards mitarbeitet, deren Fehlen nun als Begründung für die Verzögerung dient, ist fast schon poetisch.
🔗 netzpolitik.org zum Streit um den AI Act
Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat genug: Nach US-Sanktionen gegen Mitarbeiter, die bis zur Sperrung des E-Mail-Zugangs des Chefanklägers führten, ersetzt die Institution Microsoft-Software durch OpenDesk - eine vom Bund entwickelte Open-Source-Lösung.
Was nach Verwaltungskleinigkeit klingt, ist politisch ein Paukenschlag: Wenn selbst internationale Gerichte ihre Kommunikation nicht mehr US-Anbietern anvertrauen, zeigt das, wie tief die Abhängigkeit bereits reicht.
OpenDesk stammt vom Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS), das zunehmend zu einem der wichtigsten Akteure europäischer IT-Politik wird.
Die Deutsche Telekom baut gemeinsam mit Nvidia in München eines der größten KI-Rechenzentren Europas. In einem grundsanierten Gebäude im Münchner Tucherpark sollen ab Anfang 2026 rund 10.000 Nvidia-GPUs für industrielle KI-Anwendungen arbeiten. Das Investitionsvolumen liegt bei etwa einer Milliarde Euro.
Mit im Boot: SAP als Softwarepartner sowie erste Kunden wie Siemens, Agile Robots und Perplexity. Sogar der Drohnenhersteller Quantum Systems will die neue Infrastruktur nutzen, um KI-Modelle für militärische und industrielle Zwecke zu trainieren. Telekom-Chef Tim Höttges spricht von „verbindlichen Verpflichtungen" – die Nachfrage scheint also gesichert, bevor die Anlage überhaupt ans Netz geht.
Die KI-Fabrik soll die deutschen Rechenkapazitäten um rund 50 Prozent erhöhen und ist Teil einer größeren europäischen Strategie: Die EU plant mehrere sogenannte AI-Gigafactories mit mindestens 100.000 GPUs, um den technologischen Rückstand gegenüber den USA und China zu verringern. Das Münchner Projekt gilt als Vorläufer – technisch abhängig von Nvidia, politisch aufgeladen als Versuch, europäische Rechenmacht zurückzuerobern.
🔗 tagesschau.de: Telekom und Nvidia planen riesiges KI-Rechenzentrum
Wie das Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS) auf LinkedIn berichtet, gibt es künftig eine Doppelspitze unter gemeinsamer Leitung von Pamela Krosta-Hartl und Alexander Pockrandt. Krosta-Hartl, bisher Leiterin Strategie und Kommunikation, bringt langjährige Erfahrung aus dem DigitalService des Bundes und der Privatwirtschaft mit.
Das ZenDiS wird zunehmend zum institutionellen Rückgrat staatlicher Open-Source-Strategien - und genau dort braucht es Führung, die politische Pragmatik und technische Realität zusammenbringt.
Ich wünsche viel Erfolg Frau Krosta-Hartl.
Arte zeigt mit „Der digitale Tsunami", wie tiefgreifend die digitale Infrastruktur unsere Wahrnehmung verändert – von Social-Media-Dopamin bis zu autonomen Waffen. Mit Sherry Turkle, Yoshua Bengio und einem Wiedersehen mit McLuhan: „Das Medium ist die Botschaft" – diesmal algorithmisch verstärkt.
Sehenswert, weil die Doku nicht erklärt, sondern zeigt, wie Normalität kippt, wenn Maschinen entscheiden, was wir sehen.
6. November | Innovation Center, Universität des Saarlandes, Saarbrücken Panels zu vertrauenswürdiger KI, Startup-Pitches, Keynotes von CISPA bis BSI – und Heiko Maas mit einem Ausblick auf Cybersicherheit als Industriepolitik. Ich werde vor Ort sein. Bericht folgt nächste Woche.
OpenAI bereitet laut Reuters einen Börsengang mit bis zu 1 Billion US-Dollar Bewertung vor. Die Firma schreibt weiter Verluste, will aber in Infrastruktur und Übernahmen investieren und strukturiert sich als Public Benefit Corporation (PBC) neu, um zwischen Profit und Gemeinwohl zu lavieren.
Microsoft bleibt mit 27 % beteiligt und kassiert 20 % der Umsätze – was die Frage aufwirft, wie unabhängig „unabhängig" eigentlich ist.
Vielen Dank für die Inspiration Harald Wehnes

Diese Woche zeigt, wie sich das Machtverhältnis im Digitalen verschiebt: Staaten und Institutionen beginnen, die Abhängigkeiten zu erkennen, die sie selbst geschaffen haben. Was als technische Modernisierung verkauft wurde, entpuppt sich als politisches Risiko und Open Source wird plötzlich zum Sicherheitskonzept.
Editorial: Diese Woche hat vor allem eines gezeigt: Digitale Souveränität ist kein Strategiepapier, …
Regulierung wird Code, Open Source wird Infrastruktur, Souveränität wird… Marketing? 🧠 Editorial …
🧠 Editorial Diese Woche markiert eine Verschiebung. Weg von der Frage, ob digitale Abhängigkeiten …