Vendor Lock-in – Wenn Architektur zur Abhängigkeit wird
Vendor Lock-in bezeichnet die technisch, wirtschaftlich oder rechtlich eingeschränkte Fähigkeit, …
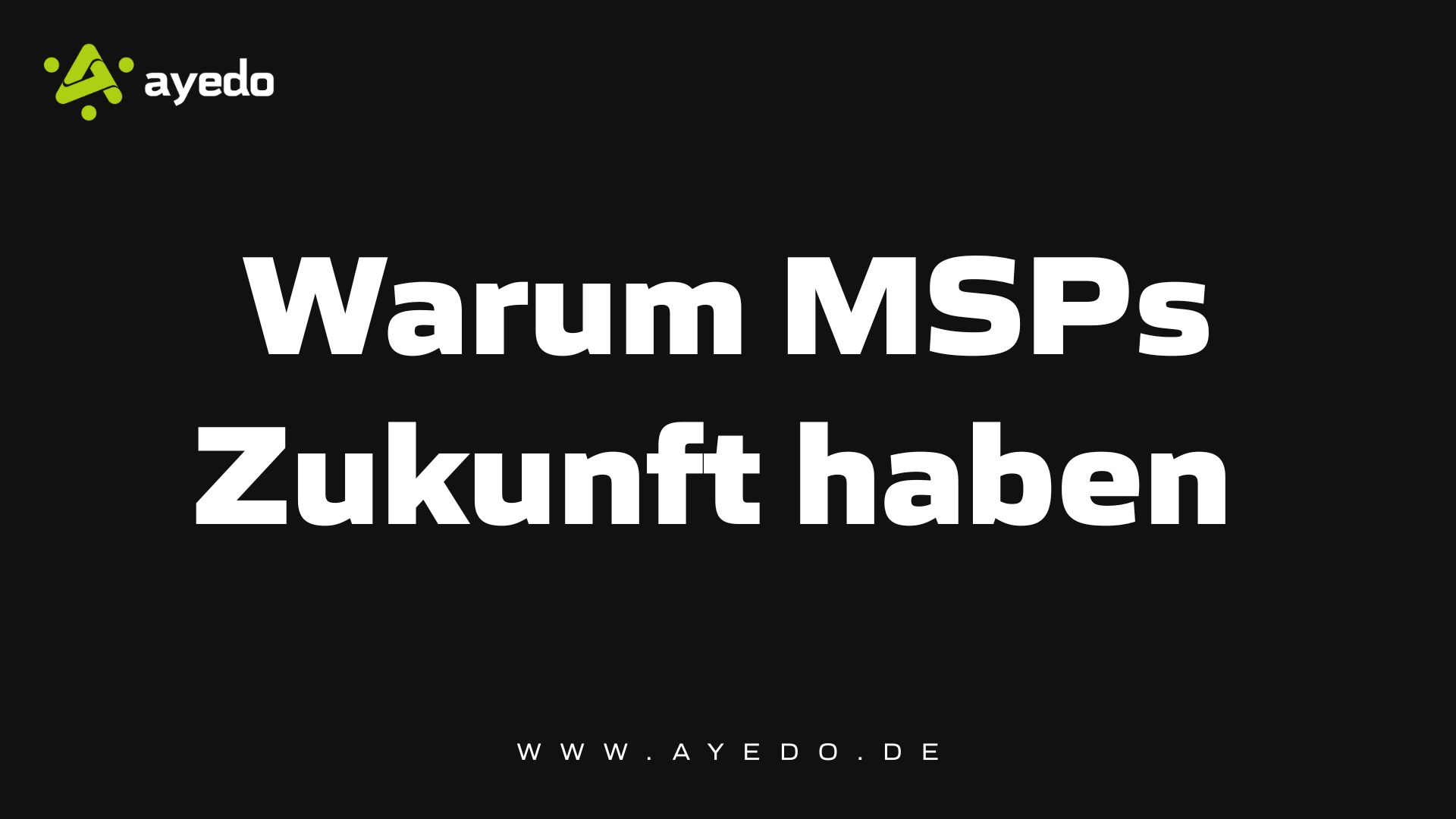
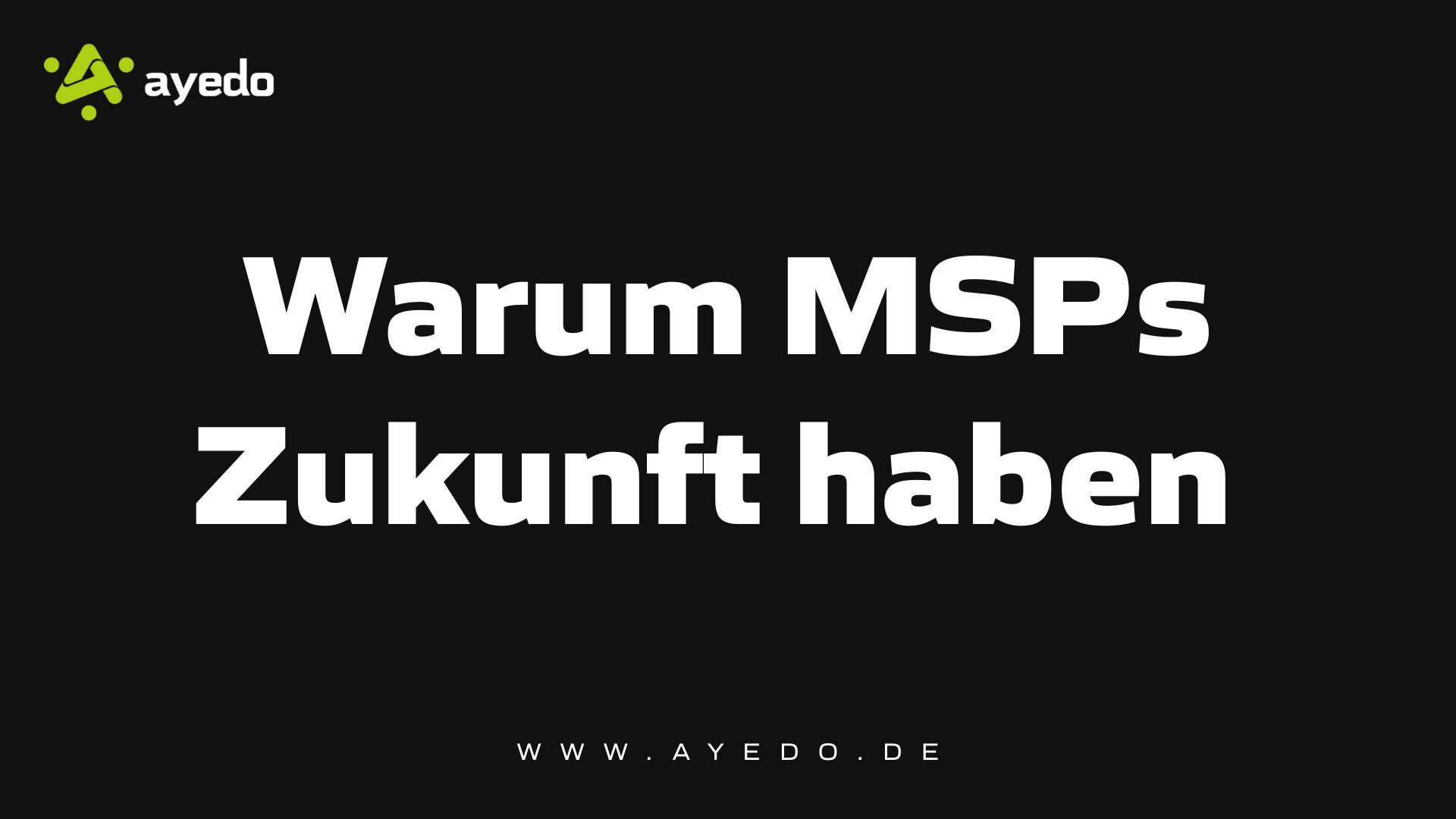
Hyperscaler haben die digitale Welt geprägt wie kaum ein anderes Modell. Mit dem Versprechen unbegrenzter Skalierung, globaler Verfügbarkeit und scheinbar unendlicher Innovation haben sie eine ganze Generation von IT-Strategien dominiert. Doch schaut man genauer hin, bleibt von dieser Erzählung wenig übrig: Das Geschäftsmodell der Hyperscaler basiert bis heute fast ausschließlich auf dem Verkauf von Hardware – Compute, Storage, Netzwerktraffic. Schick verpackt, global distribuiert, in APIs gegossen, aber im Kern immer noch dieselbe Logik: Du mietest Maschinen.
Die Effizienz der Hyperscaler liegt in der Standardisierung. Jeder Service, den sie anbieten, ist darauf optimiert, millionenfach identisch ausgeliefert zu werden. Anpassungen sind nicht vorgesehen, weil sie die Kostenkurve stören. Wer etwas außerhalb dieser Norm benötigt, zahlt einen hohen Preis – sei es für Spezial-Integrationen, Support oder schlicht für Konfigurationen, die nicht dem „Happy Path" entsprechen.
Für Unternehmen mit besonderen Anforderungen wird der vermeintlich günstige Einstieg so schnell zur Kostenfalle. Nicht, weil die Technologie schlecht wäre, sondern weil das Geschäftsmodell keine Individualität zulässt. Hyperscaler verdienen am Volumen, nicht an deinem Problem.
Managed Service Provider (MSPs) verfolgen einen grundlegend anderen Ansatz. Sie verkaufen nicht bloß nackte Ressourcen, sondern kombinieren Infrastruktur mit Fachwissen. Wo der Hyperscaler eine API liefert, bringt der MSP ein Team aus Spezialisten mit. Wo der Hyperscaler Standard-Services anbietet, baut der MSP Lösungen, die sich in bestehende Prozesse und Systeme integrieren lassen.
Ein MSP wie ayedo bietet beispielsweise nicht nur Kubernetes-Cluster, sondern komplette Managed Apps – von Datenbanken über Monitoring bis hin zu Identity Management. Dabei setzen sie auf offene Standards und vermeiden Vendor Lock-in durch proprietäre Services.
Für Entwickler bedeutet das: weniger Frust beim Jonglieren von Eigenheiten proprietärer APIs, mehr Unterstützung beim Aufbau stabiler, sicherer Systeme. Für Entscheider heißt es: keine Blackbox, sondern ein Partner, der nicht nur Infrastruktur bereitstellt, sondern Verantwortung übernimmt.
Das ist der entscheidende Unterschied: Während Hyperscaler ihre Kunden in immer tiefere Abhängigkeiten ziehen, verstehen sich MSPs als Teil der Wertschöpfungskette. Sie liefern nicht nur Rechenleistung, sondern gestalten mit. Sie helfen, regulatorische Vorgaben einzuhalten, komplexe Sicherheitsarchitekturen aufzubauen oder Anwendungen so zu betreiben, dass sie wirklich resilient und skalierbar sind.
Konkret bedeutet das: Statt auf proprietäre Lösungen zu setzen, nutzen MSPs offene Standards wie Container und Kubernetes. Sie bieten Consulting für die Migration bestehender Anwendungen und übernehmen den kompletten Betrieb inklusive Support rund um die Uhr.
Gerade in Zeiten, in denen digitale Souveränität und Compliance zu strategischen Fragen werden, zeigt sich der Mehrwert: MSPs geben Unternehmen die Kontrolle zurück, wo Hyperscaler sie entziehen.
Hyperscaler wirken modern, mit ihren glänzenden Plattformen und globalen Reichweiten. Doch im Kern sind sie nichts anderes als Hardwarehändler im XXL-Format. Wer darauf allein setzt, kauft Standardware – und bezahlt teuer, sobald es um individuelle Anforderungen geht.
Die Zukunft gehört jenen, die Technologie mit Expertise kombinieren, die Verantwortung übernehmen und Kunden nicht als Volumen, sondern als Partner sehen. Mit anderen Worten: Die Zukunft gehört den Managed Service Providern.
Vendor Lock-in bezeichnet die technisch, wirtschaftlich oder rechtlich eingeschränkte Fähigkeit, …
70 % der europäischen Unternehmen halten ihre Abhängigkeit von nicht-europäischer Technik für zu …
Am 14. Oktober 2025 endet der reguläre Support für Windows 10. Was für viele IT-Abteilungen …